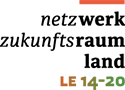Projekt Leerstand - Kleinregion Südliches Weinviertel
Positionspapier
- Themenbereich
- Basisdienstleistungen, Leader, Gemeinden
- Umwelt, Biodiversität, Naturschutz
- Klimaschutz und Klimawandel
- Untergliederung
- Umweltschutz
- Naturschutz
- Wasser
- Klimawandelanpassung
- Nahversorgung
- Interkommunale Kooperation
- Gemeindeentwicklung
- Standortentwicklung
- Leerstand
- Projektregion
- Niederösterreich
- Lokale Aktionsgruppe
- LAG Weinviertel Ost
- LE-Periode
- LE 14–20
- Projektlaufzeit
- 2023-2023
- Projektkosten gesamt
- 13.092,00€
- Fördersumme aus LE 14-20
- 9.164,00€
- Massnahme
- Basisdienstleistungen und Dorferneuerung in ländlichen Gebieten
- Teilmassnahme
- 7.2 Förderung für Investitionen in die Schaffung, Verbesserung oder Ausdehnung aller Arten von kleinen Infrastrukturen, einschließlich Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeinsparungen
- Vorhabensart
- 7.2.3. Umsetzung von Klima- und Energieprojekten auf lokaler Ebene
- Projektträger
- Regionalentwicklungsverein Südliches Weinviertel
Kurzbeschreibung
Das Projekt zeigte, wie wichtig die Themen Leerstand und Baulandmobilisierung für die Region sind: knapper werdende Flächen, steigende Preise und der Bedarf an nachhaltiger Siedlungsentwicklung erfordern gemeinsames Handeln. In einem strukturierten Prozess wurden Erfahrungen gesammelt, Austausch angeregt und gemeinsame Lösungen erarbeitet. Ziele, Wünsche und Bedingungen der 13 Gemeinden flossen in Strategien zur Nachverdichtung und Wiederbelebung bestehender Strukturen ein. Grundlage waren ein intensiver Dialog mit regionalen Stakeholdern, individuelle Gemeindegespräche, fachliche Analysen sowie ein gemeinsamer Workshop mit Vertreter:innen aller Gemeinden. Ergebnis war ein einstimmig beschlossenes Positionspapier, das als Handlungsgrundlage für politische Entscheidungen dient und in Form einer öffentlichkeitswirksamen Broschüre aufbereitet wurde.
Ausgangssituation
Österreich ist im EU-Vergleich mit 11,5 ha pro Tag (Umweltbundesamt 2021) eines der Länder, in denen die Bodenversiegelung am höchsten ist. Durch diese massive Bodenversiegelung geht biologisch produktiver Boden meist für immer verloren und damit auch die natürlichen Bodenfunktionen. Die Auswirkungen werden durch das veränderte Klima immer deutlicher spürbar: Bei Unwettern kann der versiegelte Boden kein Wasser mehr aufnehmen – es kommt zu Überschwemmungen, der Boden verliert seine kühlende Wirkung, sodass es immer heißer wird. Auch die Staubbindungsfunktion des Bodens geht zurück.
Den größten Anteil an der bisherigen Versiegelung haben Verkehrsflächen, gefolgt von Bauflächen und Betriebsflächen. Eine Maßnahmenempfehlung gegen den Bodenverbrauch ist daher die Nachverdichtung im bebauten Siedlungsgebiet.
Leerstände werden zu einer immer brisanteren Thematik in unseren Gemeinden. Immer mehr Gebäude bzw. Geschäftsflächen stehen in den Ortszentren leer, aber auch vor unserem Kulturgut Kellergasse nimmt dieser Negativtrend keinen Halt. All diese Entwicklungen führen zu erhöhten Kosten für Gemeinden, notwendige Umwidmungen an den Ortsrändern sowie einem Verlust von Dorfgemeinschaft. Diese Situation ergibt ein Aussterben der Dorf- und Stadtzentren und damit einem Bedeutungsverlust der Gemeinde. In der nordost-italischen Region Friaul sind sogenannte „Geisterdörfer“ keine Seltenheit mehr. Laut einer Studie von Margit Aufhauser-Prinz und Elisabeth Polly sind 24,6% des gewidmeten Baulandes in Niederösterreich aktuell nicht bebaut, der Grund dafür: viele Besitzer von Bauland horten es seit Jahrzenten – oft in guter Absicht als Vorsorge für die eigenen Kinder oder Enkel, manchmal auch als Spekulationsgründen.
Dieses Vorgehen kostet den Gemeinden aber auch den Bürger:innen viel Geld, so sehen die Studienautorinnen die Kosten für die Aufschließung eines Quadratmeters Bauland bei rund € 24,00, jedoch auch die Erhaltung dieses Quadratmeters kostet anschließend € 0,40 pro Jahr. (NÖN Niederösterreich, 06/2021, 2021-02)
»In Südtirol ist der klassische Nahversorger in den Orten immer noch im Zentrum. Und dort ist auch das Leben. Man geht einkaufen, setzt sich wo hin, trinkt einen Kaffee. Viele schätzen die Aufenthaltsqualität und zufällige Begegnungen an den italienischen Orten, fahren dort gerne hin. Gleichzeitig machen wir aber genau das Gegenteil bei uns in Österreich«, zeigt sich Roland Gruber Architekt und Raumplaner unverständlich. Er hofft auf ein Umdenken vieler weiterer Gemeinden und Städte. Im aktuellen Regierungsprogramm in Österreich ist die Stärkung der Orts- und Stadtkerne zumindest festgehalten.
Ziele und Zielgruppen
Hier sind die Zielgruppe klar politische Entscheidungsträger. Bürgermeister:innen, Amtsleiter:innen, (wenn vorhanden) Leerstandsbeauftragte und beauftragte Gemeinderät:innen. Das Ergebnis des erarbeiteten Papiers soll aber auch der Bevölkerung sowie den politischen Entscheidungsträger:innen höherer Instanzen verfügbar gemacht werden. Ziel des Projekts ist es alle vorhandenen Tätigkeiten und Initiativen zu fokussieren und so Synergien zu nutzen und die Thematik anzupacken.
Dadurch soll der Bodenversiegelung entgegengewirkt und Leerstände und ungenutzte Flächen aktiviert werden. Dafür soll ein gemeinsames Positionspapier von 13 Gemeinden zum Thema Leerstand erarbeitet werden.
Aus den begonnenen Projekten sollen Erfahrungen für alle aufbereitet werden. Das gemeinsame Positionspapier soll auf die Leerstandsthematik aufmerksam machen, die in der Region unterschiedliche Entwicklungen nimmt und nicht nur ein zunehmendes sondern auch ein politisches Problem ist. Die Thematik soll auch aus der Region hinausgetragen werden. Dazu möchten sich die Bürgermeister zusammentun. Es sollen Lösungsansätze gefunden werden.
Projektumsetzung und Maßnahmen
- Vorbereitung in Abstimmung mit der Region
- Austausch mit relevanten Stakeholdern der Region
- Optional (wird mit beauftragt) 13 individuelle Gemeindegespräche
- Fachliche Aufbereitung der Themen durch das Projektteam o Konzeption und inhaltliche Planung des Workshops
- Gemeinsamer Workshop, Termine zur Ausarbeitung 1-2 Tage
- Leerstandsthematik in der Region
- Herausforderungen und Lösungsansätze ausarbeiten
- Workshop bestehend aus 13 Vertreter:innen der Region
- Ausarbeitung und Entwurf des Positionspapiers
- Dokumentation des gesamten Prozesses
- Öffentlichkeitswirksame Broschüre (Positionspapier)
- Textierung
- Lektorat
- Abstimmung mit der Region
- Aufbereitung Druck-Layout
Ergebnisse und Wirkungen
Das oberste Ziel dieses Projektes ist es wertvollen Boden nicht mehr zu versiegeln und den Bodenverbrauch zu verringern. Das Hintanhalten der Bodenversiegelung durch die Nutzung von Leerstand ist ein wichtiger Bestandteil. Durch das gemeinsame Positionspapier wurde eine Handlungsgrundlage für zukünftige Entscheidungen getroffen. Das durchgeführte Projekt soll zu einer nachhaltigen Raumentwicklung beitragen. Durch die das gemeinsame Position beziehen wird langfristig „an einem Strang gezogen“ und so können langfristig Erfolge erzielt werden. Besonders folgende Punkte sind für eine nachhaltige Raumentwicklung sehr wichtig: Erhaltung und Verbesserung der Klimaresilienz
- Regulation des Kleinklimas für Mensch und Umwelt
- lokaler Wasserrückhalt auf der Fläche
- Sicherung der Produktionsfähigkeit des Bodens
- Ermöglichung von kurzen Wegen durch die Nutzung innerörtlicher, zentrumsnaher Immobilien und damit Stärkung der Zentren beziehungsweise der bestehenden, innerörtlichen Versorgungsinfrastruktur
- Sicherung der Lebensqualität in den ländlichen Gemeinden (durch die Neuinterpretation der Nutzungsmöglichkeiten des Leerstandes, durch funktionierende Ortszentren mit Treffpunkten für die Bevölkerung, durch gemeinsame Initiativen zur Belebung des Ortes, durch das Lösen wichtiger gesellschaftlicher Aufgaben im Ort und nicht außerhalb (zum Beispiel Altenbetreuung, ...), durch die Stärkung der Dorfgemeinschaft, durch die Sicherstellung des Ortes als resilientes System, ...)
Erfahrung
Die interkommunale Zusammenarbeit der 13 Gemeinden hat gezeigt, dass gemeinsame Beschlüsse und ein abgestimmtes Vorgehen enorme Schlagkraft bei einem komplexen Thema wie Baulandmobilisierung und Leerstandsmanagement entfalten. Besonders wertvoll war die frühzeitige Einbindung der Bürger:innen, die nicht nur für Akzeptanz, sondern auch für praxisnahe Ideen gesorgt hat. Kritische Momente waren vor allem die politische Einigkeit in den Gemeinderäten sowie die Präsentation des Positionspapiers in den Ministerien, die für die Sichtbarkeit und Weiterentwicklung entscheidend waren. Aus dem Projekt haben wir gelernt, dass neben einer faktenbasierten Analyse auch eine kontinuierliche Kommunikation und Erfolgsmessung wichtig sind. Bei einer erneuten Durchführung würden wir die Beteiligung noch breiter anlegen und digitale Formate stärker nutzen, um noch mehr Menschen einzubeziehen.
Pdf-Ausgabe
weitere Bilder
REV Südliches Weinviertel
REV Südliches Weinviertel
REV Südliches Weinviertel