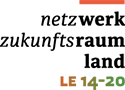Kultur & Rad an der Eisenstraße OÖ, STMK; NÖ
Nachhaltige Tourismusentwicklung
- Themenbereich
- Innovation
- Untergliederung
- Wertschöpfung
- Tourismus
- KMUs, Gewerbe & Wirtschaft
- Klimawandelanpassung
- Klimaschutz
- Kultur
- Wissenstransfer
- Projektregion
- Niederösterreich
- Oberösterreich
- Steiermark
- LE-Periode
- LE 14–20
- Projektlaufzeit
- 10.23-12.24
- Projektkosten gesamt
- 97.750,97€
- Fördersumme aus LE 14-20
- 66.522,27€
- Massnahme
- Zusammenarbeit
- Teilmassnahme
- 16.2 Förderung für Pilotprojekte und für die Entwicklung neuer Erzeugnisse, Verfahren, Prozesse und Technologien
- Vorhabensart
- 16.02.2. a) Unterstützung bei der Entwicklung von innovativen Pilotprojekten im Tourismus - BMWFW
- Projektträger
- Tourismusverband Steyr + Nationalpark Region
Kurzbeschreibung
Die Stadt Steyr und die österreichische Eisenstraße (Niederästerreich, Oberösterreich, Steiermark) kämpfen mit inhomogenen touristischen Angeboten und starken Nachfrageschwankungen. Der Klimawandel bedroht besonders den Natur- und Sporttourismus (Hochwasser, Schneemangel), während Corona den Wirtschaftstourismus verändert hat. Das Projekt zielt auf eine Neuausrichtung ab: Die Region soll als bundesländerübergreifende Perlenkette für Kultur- und Radtourismus positioniert werden, basierend auf der identitätsstiftenden „DNA Eisen“. Kernziel ist die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes zur Anpassung an den Klimawandel und die Etablierung eines resilienten Ganzjahresangebots.
Hauptzielgruppen sind Betriebe der Tourismus- und Freizeitwirtschaft.
Ergebnisse:
- Broschüre „klimafitte Betriebe“
- Konzept „Rad und Kultur“ (Umsetzung ab 2025)
- Planung einer bundesländerübergreifenden Museumskarte
- Initiative „Die Eisenstraße als UNESCO Welterbe“
Ausgangssituation
Die Stadt Steyr und die umliegende Region Nationalpark liegen an der österreichischen Eisenstraße. Sowohl Steyr als auch die gesamte Eisenstraße ist touristisch sehr inhomogen aufgestellt. Die einzelnen Gemeinden und Anbieter sprechen völlig unterschiedliche Zielgruppen an und kämpfen mit starken Nachfrage-Schwankungen. Durch die hohe Saisonalität ist der Naturtourismus durch den Klimawandel stark bedroht (Hochwasser, Abbrüche in den Wandergebieten), der Sporttourismus ist schon jetzt durch den Klimawandel (Hochwasser an den Flüssen die für Rafting/Wassersport genutzt werden, Schneemangel in den Skigebieten) stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Wirtschaftstourismus in Steyr unterliegt seit Corona durch die Veränderungen in diesem Sektor (Online-Meetings) auch immer stärkerer Nachfrageschwankungen.
Für die Zukunft ist die Absicherung des Tourismussegments durch den Klimawandel in der ganzen Region gefährdet. Dieses Projekt soll der Startschuss für eine komplette Neuausrichtung sein, aufbauend auf den Traditionen und Stärken hin zu einer Musterregion für Ganzjahrestourismus, die sich erfolgreich an den Klimawandel anpasst. Daher wurde nicht nur für einen Tourismusverband sondern gleich für die ganze Region ein gemeinsames Zielbild entwickelt: Die Region als innovative, bundesländerübergreifende Perlenkette für Kultur- und Radtourismus im ländlichen Raum zu positionieren.
Regional wird dazu die gesamte Eisenstraße in Niederösterreich (NÖ), der Steiermark (Stmk.) und Oberösterreich (OÖ) einbezogen. Der inhaltliche Schwerpunkt soll auf der identititässtiftenden und über Jahrhunderte verankerten DNA „Eisen“ liegen. Diese Substanz soll mit innovativen an den Klimawandel angepassten Angeboten (Kultur in Verbindung mit Rad mit einem Rad-Leitprodukt „Eisenstraße“) lebendig und dadurch für neue internationale Zielgruppen ein höchst begehrenswertes Reiseziel werden.
Durch dieses Projekt soll die Österreichische Eisenstraße ein innovatives Leuchtturmprojekt für die Anpassung an den Klimawandel und die Resilienz im Tourismus und seiner verbundenen Wirtschaftszweige werden. Im Kern steht dabei die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes mit allen relevanten Stakeholdern entlang der Eisenstraße NÖ, Steiermark und OÖ. Ein erster Vor-Workshop mit rund 30 Stakeholdern zeigte, dass das Thema einer gemeinsamen Neuausrichtung für einen gestärkten Kulturtourismus im ländlichen Raum auf großes Interesse stößt und alle Anspruchsgruppen die Zukunftsentwicklung zur Stärkung des Tourismusangebotes mittragen werden.
Ziele und Zielgruppen
Ziele Durch dieses Projekt soll eine Anpassung der gesamten Region (NÖ, Stmk., OÖ) auf den Klimawandel und Ausrichtung auf ein kulturtouristisch motiviertes Ganzjahresangebot erfolgen, um mit den regionalen Besonderheiten (einzigartiges Kulturgut in Kombination mit Radangebot und Mobilitätsketten und einem Leitprodukt „Rad an der Eisenstraße“ ) neue Zielgruppen anzusprechen. Durch dieses Projekte soll die Österreichische Eisenstraße ein innovatives Leuchtturmprojekt für die Anpassung an den Klimawandel und die Resilienz im Tourismus und seiner verbundenen Wirtschaftszweige werden. Im Zentrum steht dabei die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes mit allen relevanten Stakeholdern entlang der Eisenstraße NÖ, Steiermark und OÖ. Die Entwicklung dieses Anpassungskonzeptes erfolgt mit fachlicher Begleitung von fundierten Expert:innen aus dem Bereich Klimaforschung, Nachhaltigkeit, Tourismus und Zukunftsfragen der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Zielgruppen Hauptzielgruppen beziehungsweise direkte Profiteuere sind Betriebe der Tourismus- und Freizeitwirtschaft insbesondere aus den Bereichen Beherbergung und Gastronomie, Kulturbetriebe, Museen, Moblilitätsanbieter und Organisationen die Kultur- und Freizeitangebote vermitteln.
Projektumsetzung und Maßnahmen
Durch den Fördercall des BMAW wurde entlang der Österreichischen Eisenstraße ein Leuchtturmprojekt für die Anpassung an den Klimawandel und die Resilienz im Tourismus und seiner verbundenen Wirtschaftszweige initiiert. Im Kern stand dabei die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes mit allen relevanten Stakeholdern entlang der Eisenstraße Niederösterreich, Steiermark und Oberösterreich. 1. Maßnahme: SWOT Analyse
- zur Standortbestimmung erhob die Johannes Kepler Universität Linz die touristischen Entwicklungspotenziale
- parallel dazu erarbeitete die WU Wien, Institut für Nachhaltigkeits-Management, die regionalen Anforderungen an den Klimawandel Ergebnis
- aus diesen Analysen konnte abgeleitet werden, welche Möglichkeiten für einen ganzjährigen resilienten Tourismus für die Zukunft die größten Erfolgswahrscheinlichkeiten haben
2. Maßnahme: Definition der Potenziale
um die Ergebnisse der SWOT Analyse zu konkretisieren wurde in einem 2-tägigen Workshop mit Expertinnen und Experten festgelegt, wo im Detail die größten Potenziale liegen Ergebnis
- es wurde ein klares Profil erstellt, wie ein grenzüberschreitendes Angebot künftig aussehen kann und welche Akteuere miteinzubinden sind
3. Maßnahme: Austauschprozess Stakeholder
- alle Erkenntnisse aus den bisherigen Arbeitsschritten wurden an rund 50 Stakeholder vorgestellt und mit ihnen diskutiert; teilgenommen haben Tourismusbetriebe, Tourismusverbände, Kultureinrichtungen, Mobilitätspartner:innen, und so weiter.
- Ergebnis: das Grobkonzept wurde geschärft und gemeinsam beschlossen, wie die Gemeinden eingebunden werden sollen
4. Maßnahme: Detailkonzeption
- gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien und den Tourismusverbänden „Steyr und die Nationalparkregion“, „Mostviertel“, „Gesäuse“, „Bad Hall“ wurde das Konzept im Detail erarbeitet Ergebnis
- für die Betriebe soll es eine einfach verständliche Broschüre geben, wie sie sich selbst bestmöglich klimafit aufstellen
- für die Betriebe soll es zur Verlängerung der Aufenthaltsdauer der Gäste aber auch zur Neuansprache von Gästen neue Radangebote entlang der Sehenswürdigkeiten der Eisenstraße geben
- ergänzt wird dies von einer Museums-Karte für Gäste, die es ermöglicht, in allen 3 Bundesländern die Museen entlang der Eisenstraße zu besuchen
- parallel dazu soll der Lebensraum durch die Auszeichnung als UNESCO-Welterbe gestärkt werden
5. Maßnahme: Austauschprozess Bevölkerung
- gemeinsam mit den Bundesländern Niederösterreich, Steiermark und Oberösterreich wurde in jedem Bundesland eine Informationsveranstaltung für die interessierte Bevölkerung durchgeführt: in Oberösterreich in Steinbach an der Steyr, in der Steiermark in Trofaiach und in Niederösterreich in Waidhofen an der Ybbs
- Ergebnis: das Konzept und die nächsten Schritte wurden vorgestellt und das Feedback dazu eingeholt
6. Maßnahme: Austauschprozess Stakeholder
- in der Zwischenzeit wurde ein Projekt bereits in die Umsetzung gebracht: die Broschüre, welche Maßnahmen Betriebe setzen können, um sich bestmöglich auf den Klimawandel vorzubereiten
- dazu wurden Erkenntnisse aus einem ähnlichen Projekt in der Steiermark eingearbeitet, sodass Synergien genutzt werden konnten (gemeinsamer Stakeholder-Workshop im September in Palfau/Steiermark)
- die Ergebnisse wurden an rund 50 Stakeholder vorgestellt und mit ihnen diskutiert: teilgenommen haben Tourismusbetriebe, Tourismusverbände, Kultureinrichtungen, Mobilitätspartner:innen, Gemeinden die ihre Erfahrungswerte weitergaben sowie Bildungseinrichtungen (HTL Steyr)
- Ergebnis: das Konzept wurde nochmals verfeinert und für die nächsten Umsetzungsschritte freigegeben
7. Maßnahme: Ergebnispräsentation in Leoben
- alle Ergebnisse wurden bei einem Symposium in Leoben vorgestellt: teilgenommen haben rund 70 Vertreter:innen von Tourismusbetrieben, Tourismusverbänden, Kultureinrichtungen, Bildungseinrichtungen usw. Ergebnisse
- die fertige Broschüre für Betriebe wurde präsentiert
- die Schritte für die Umsetzung der bundesländerübergreifenden Angebote zum Thema Rad und Kultur sowie Museumskarte wurden vorgestellt und mit dem Zeithorizont 2025 versehen
- die nächsten Schritte für eine mögliche Ankerkennung als UNESCO Welterbe wurden mit einem Zeitplan bis 2026 hinterlegt
Ergebnisse und Wirkungen
Projekt „klimafitte Betriebe“ - die Broschüre wird den Betrieben entlang der Österreichischen Eisenstraße zur Verfügung gestellt
- der WKO/FV Hotellerie wurde die Broschüre auch vorgestellt und ein Basisset an Drucksorten für die Verteilung an Beherbergungsbetriebe übermittelt
- die Ergebnisse werden in allen TVBs vorgestellt
- die Broschüre ist Online für alle Interessenten abrufbar: https://www.steyr-nationalpark.at/fileadmin/user_upload/steyr-nationalparkregion/Service/Prospekte_Titelbilder_pdf/TVB_klimabroschüre_FINAL.pdf
Projekt „Rad und Kultur“: nachdem das Konzept für ein neues Radangebot in der Verbindung von Kulturattraktionen entlang der Österreichischen Eisenstraße positiv aufgenommen wurde, wird dieses ab 2025 in die Umsetzung gebracht Projekt „bundesländerübergreifende Museumskarte“
- das Konzept für eine Gästekarte zum Besuch der Museen entlang der Eisenstraße wurde positiv aufgenommen. An der Umsetzung wird ab 2025 gemeinsam mit den TVBs gearbeitet
Projekt „Die Eisenstraße als UNESCO Welterbe“
die Vereine der drei Eisenstraßen NÖ, OÖ und STMK haben beschlossen, einen gemeinsamen Förderverein zu gründen und finanzieren
Erfahrung
Zum Projektabschluss wurden von den Schlüsselakteuren in einer Sitzung Feedback eingeholt. Qualitative Rückmeldungen
- aus dem Tourismus wurde mit Hilfe des BMAW ein großartiges Projekt angestoßen und die Region hat sich neu vernetzt und arbeitet erstmalig gemeinsam konkret zusammen
- die handelnden Personen haben sich durch die Austauschprozesse vielfach erstmalig kennen gelernt und arbeiten viel besser zusammen
- es gibt einen neuen „Eisenstraße-Drive“: 3 Bundesländer arbeiten erstmalig an gemeinsamen Zielen
- es wurde in diesem Jahr sehr vieles geschafft, der Ausgangspunkt über die Förderung des BMAW war dafür ganz wichtig
- die Gemeindetreffen in OÖ, NÖ und der Steiermark haben sehr geholfen, die Themen vor Ort zu verankern
- dieses Projekt war der wichtigste Meilenstein in der bundesländerübergreifenden Zusammenarbeit der letzten Jahre
- wir haben durch dieses Projekt erkannt, wie wir zusammenarbeiten können und wo unsere Gemeinsamkeiten liegen und wie wir Synergien viel besser nutzen können
- die Endpräsentation beim Symposium in Leoben ist sehr gut gelungen
- alle ziehen an einem Strang, der Prozess ist sehr gut gelungen Lernerfahrungen erfolgsentscheidend war, dass wir in permanenten Austausch mit den Stakeholdern waren und ihre Sichtweisen berücksichtigt haben kritische Momente trotz engem Zeitkorsett die Termine und Inhalte konsequent einzuhalten