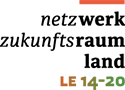Übergänge gestalten
- Themenbereich
- Basisdienstleistungen, Leader, Gemeinden
- Untergliederung
- Schutzgebiete
- LEADER
- Interkommunale Kooperation
- Bildung & Lebenslanges Lernen
- Projektregion
- Vorarlberg
- Lokale Aktionsgruppe
- LAG REGIO-V Regionalentwicklung Vorarlberg
- LE-Periode
- LE 14–20
- Projektlaufzeit
- 19.08.2022-31.10.2024
- Projektkosten gesamt
- 107.418,91 €
- Fördersumme aus LE 14-20
- 64.451,35 €
- Massnahme
- Förderung zur lokalen Entwicklung (CLLD)
- Teilmassnahme
- 19.2. Förderung für die Durchführung der Vorhaben im Rahmen der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategie für lokale Entwicklung
- Vorhabensart
- 19.2.1. Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie
- Projektträger
- Regionalplanungsgemeinschaft Großes Walsertal
Kurzbeschreibung
Im Projekt wurden im Großen Walsertal das gemeinsame Lernen, ein Diskurs zur verstärkten Kooperation und die Gestaltung von ganzheitlichen Betrachtungen im Zusammenspiel von Politik, Fachleuten und Zivilgesellschaft behandelt. Ausgehend von der Frage, ob die bestehenden Strukturen, Formate und Abläufe geeignet sind, um das größtmögliche Potential an Engagement, Beteiligung und gemeinwohlorientierter Zukunftsgestaltung zu entfalten und dem ganzheitlichen Auftrag einer Biosphärenparkregion gerecht zu werden, wurden Herausforderungen identifiziert und bearbeitet. Die Findung von guten Beteiligungs- und Entscheidungsstrukturen sowohl auf politischer, operativer und gesellschaftlicher Ebene wurde angestoßen. Dank einer neu geschaffenen „Koordinations-Stelle für ein gutes Miteinander“ wurden im Bereich Ehrenamt, Engagement und Beteiligung neue Impulse gesetzt und die Zusammenarbeit gestärkt. Ein Begegnungsort wurde aufgebaut und verschiedenste partizipative Formate wurden erprobt.Ausgangssituation
Die Gestaltung von Übergängen wird angesichts gesellschaftlicher Transformationen, Dynamiken und Strukturwandel immer wichtiger. Eine ständige Auseinandersetzung mit Entwicklungen und neuen Formen des Zusammenlebens und Kooperierens ist daher essentiell. Diese soll immer vom sozio-kulturellen Ende (Mindshifts) unter Einbeziehung der Identität und Werte her gedacht werden, damit nicht nur technologische und ökonomische Aspekte dominieren. Im regionalen Räumlichen Entwicklungskonzept (regREK - Beschluss im November 2019) wurden Entwicklungsziele erarbeitet, die als Orientierung in der Lösung von anstehenden Aufgaben dienen sollen - stets im Einklang mit den Grundsätzen und dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung des Biosphärenparks Großes Walsertal sowie den überregionalen Zielsetzungen. Diese Konzepte beschreiben keinen Endzustand, sondern die Richtung der Entwicklung aus heutiger Sicht. Neue Erkenntnisse und sich ändernde Rahmenbedingungen erfordern auch zukünftig eine Anpassung der Maßnahmen und Strukturen. Alle Biosphärenpark-Gemeinden haben sich mit einem Beschluss dafür ausgesprochen, diese Übergänge proaktiv gestalten zu wollen und einen Prozess mit externer Begleitung sowie eine Begleitung für die Umsetzung und das Einüben von neuen Mustern, Formaten und möglichen neuen Abläufen zu starten. In diesem soll beobachtet, gesammelt, ausprobiert, adaptiert und bis 2025 sollen mögliche Entscheidungsgrundlagen abgeleitet werden. Bezugnehmend auf Landesentwicklungen soll das Projekt eng mit der aktuellen Ausarbeitung der Beteiligungsstrategie 2023 über das Büro für Freiwilliges Engagement und Beteiligung verbunden und rückgekoppelt werden. Ebenso liegt das Positionspapier Dritte Orte vor, aus welchem Erkenntnisse aufgegriffen und in der Region umgesetzt werden.
Die Region strebt weiters an, sich dem Programm familieplus anzuschließen. Auch hier soll untersucht werden, inwieweit das Programm zur Erreichung der genannten Ziele und Wirkungen dienlich sein kann.
In einem Leerstand in St. Gerold konnte bereits eine erste Zwischennutzung als Tal/Studio erprobt und der Begriff besetzt werden. Da Zwischennutzung zeitlich begrenzt ist, ist ein mobiles Setting für höhere Wiedererkennbarkeit wichtig.
Ziele und Zielgruppen
Über den Prozess „Übergänge gestalten“ kristallisierten sich zwei Hauptstränge heraus. Der eine ist die Optimierung der operativen regionalen Einheiten der REGIO Biosphärenpark Großes Walsertal. Der andere ist die Frage, wie politische Entscheidungsfindungen in der heutigen Zeit so erweitert werden können, dass sie einerseits auf breiter Expertise beruhen und gleichzeitig die Perspektiven der Bevölkerung bestmöglich einbinden. Die ganzheitliche Entwicklungsstrategie als Modellregion Biosphärenpark Großes Walsertal wurde mit den verschiedensten Akteurinnen und Akteuren (Gemeinden, Land, operative Einheit, Bevölkerung, Fördergebende, …) breit verhandelt und abgestimmt. Ein Modell für ein neues Strukturbild unter Einbeziehung aller Beteiligten konnte entwickelt werden. Dieses wirkt einerseits nach innen, bietet sich als Reallabor jedoch auch dem Land und darüber hinaus für relevante Fragestellungen an.
Neben bestehenden ehrenamtlichen und politischen Strukturen wurden neue Formen der Teilhabe und Beteiligung erprobt. Diese erstreckten sich von Werkstätten für Ehrenamt über Projektschmieden bis hin zu Beteiligungsformaten für die Jugendlichen. Das neue Strukturbild sieht die Einsetzung eines permanenten Bürgerinnen- und Bürger-Beirats vor, um der Politik relevante Themen und Perspektiven zur Rückkopplung in politische Entscheidungsfindungen zu liefern.
Projektumsetzung und Maßnahmen
Prozessentwicklung und Prototyping Zusammen mit einer externen Begleitung, dem Büro für Freiwilliges Engagement und Beteiligung sowie unter Abstimmung mit diversen Abteilungen des Landes Vorarlberg, Gemeindeverband und weiteren Institutionen wie der inatura Erlebnis Naturschau Dornbirn wurden mögliche Prozesse und Formate sowie ein Strukturbild entwickelt. Im Laufe der letzten 50 Jahre kamen verschiedene Akteurinnen und Akteure in das System der REGIO.
Es wurden formal sämtliche Funktionen und Gremien gemäß den Statuten und Verordnungen erfasst, um ein Gesamtbild zu erhalten und weiter zu verhandeln, wie gute nächste Schritte gesetzt werden können. Die neue Stelle der „Koordination für ein gutes Miteinander“ wurde für das Projekt eingesetzt, um auf Ebene der Bevölkerung im Bereich Ehrenamt, Engagement und Beteiligung neue Impulse zu setzen und die Zusammenarbeit zu stärken. Als Verhandlungsort wurde das Tal/ Studio als neuer, offener Begegnungsort aufgebaut und verschiedenste partizipative Formate wurden erprobt. Diese erstreckten sich von Werkstätten für Ehrenamt über Projektschmieden bis hin zu Beteiligungsformaten für die Jugendlichen. Gemeinsam mit Vereinen, Organisationen und engagierten Privatpersonen wurden anhand eines Engagement-Leitfadens Handlungserfordernisse und Bedarfe identifiziert. Dabei wurden die möglichen Unterstützungen auf regionaler Ebene (Kümmerin/Kümmerer) und Landesebene (Büro für Freiwilliges Engagement und Beteiligung) herausgearbeitet. Die „Koordination für ein gutes Miteinander“ unterstützte in der Koordination, Entwicklung und Umsetzung des Festivals „Werkstatt fürs Tal“ und der Konzeptionierung und Umsetzung der Regionalwerkstatt und weiterer Formate, im Aufbau des Tal/Studios, zur Förderung von Ehrenamt, Engagement und Beteiligung.
Für die erste Auseinandersetzung zum Beitritt im Landesprogramm familieplus wurde eine umfassende Ist-Analyse zur Standortbestimmung vorgenommen. Tal/Studio Im Projekt entstand ein dritter Ort, der Begegnung rund um die Uhr (24/7 Öffnungszeiten) ermöglichte und über verschiedenste Formate wie Ausstellungen, Lesungen, Vorträge, Projektschmieden, Werkstätten für Ehrenamt zum Dialog und Zusammensein einlud. Das Tal/ Studio schaffte nicht nur Raum, um sich selbst einbringen und wirksam werden zu können, sondern machte auch sichtbar, welche Potentiale vorhanden sind, wo angeknüpft oder gemeinsam zur Lebensraumgestaltung beigetragen werden kann. So wurde der Raum immer stärker von privat engagierten Personen und Organisationen genutzt. Es fanden Stammtische von pflegenden Angehörigen, verschiedenste Vereinssitzungen und gemütliche Zusammenkünfte statt.
Ebenso nutzte die Offene Jugendarbeit Großes Walsertal die Räumlichkeiten. Für das Tal/Studio wurde ein inhaltliches und räumliches Konzept ausgearbeitet. Räumlich wurde in einem leerstehenden Hotel in St. Gerold ein offener und zweckfreier Raum für alle Menschen realisiert, der aus der historischen Gaststube einerseits (Herkunft) und einem Raum mit urbanem Flair und mobilem Setting (Zukunft) bestand. Die Erfahrungen durch den Betrieb des Tal/Studios zeigten, dass die inhaltliche Funktion - einen zweckfreien, konsumfreien Ort der Begegnung im Tal zu haben - durchaus bestätigt wurde und auch im Rahmen der „Werkstatt fürs Tal“ nochmals dezidiert von der Bevölkerung als Wunsch benannt wurde. Im Prozess zeigte sich, dass dazu jedoch kein „neuer“ Ort betrieben werden, sondern die Haltung und Funktion des Tal/Studios mehr an Bestehendes andocken soll. Somit soll das Tal/Studio künftig im biosphärenpark.haus (im Eigentum aller Gemeinden) mit seinem mobilen Setting integriert werden und die Positionierung als Begegnungs-, Lern- und Verweilort stärken. D
as biosphärenpark.haus soll als strategischer Hub für das gute Miteinander im Tal agieren und von dort ausgehend über das Biosphärenparkteam bestehende Treffpunkte in den Gemeinden miteinander koordinieren und unterstützen. Dazu gehören die Bibliotheken und Dorfläden, welche in jeder der sechs Gemeinden bestehen. Ein Begegnungs- und Beteiligungsmöbel wurde konzeptioniert, das vom biosphärenpark.haus ausgehend als Kommunikationsmittel im Themenfeld genutzt werden soll und die Orte im Tal inhaltlich miteinander verbinden und Begegnungsmomente schaffen soll. Der Bau ist im Jahr 2025 geplant.
Regionalwerkstatt
Die Regionalwerkstatt unter dem Titel „Werkstatt fürs Tal“ wurde im September 2022 als erstes definiertes Format umgesetzt. Sie bot einen stimmigen Rahmen, wo politische Gremien und zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure zusammenkamen und über zukünftige Entwicklungen und Themen verhandelten. Das Spektrum bewegte sich dabei von ganz Konkretem im Alltag bis hin zu möglichen und utopischen Zukunftsbildern. Vorträge und Workshops mit externen Impulsgebenden und Referierenden inspirierten und öffneten den Blick für Neues. Die Werkstatt fürs Tal bildete ebenso den Startschuss für den Aufbau einer kontinuierlichen Jugendbeteiligung, damit sich junge Menschen aktiv in die Mitgestaltung ihres Lebensraums einbringen können. Ein politischer Beschluss wurde gefasst, die „Werkstatt fürs Tal“ alle zwei Jahre weiter umzusetzen. Das Format nimmt künftig konkrete Fragen der Regionalentwicklung und des Zusammenlebens, verbunden mit den Impulsen, die im Walserherbst gesetzt wurden, auf und überführt diese in politische Entscheidungsprozesse. Die Werkstatt fürs Tal als Festival für Zukunfts.Gestaltung schaffte in ihrer zweiten Umsetzung im Jahr 2024 viele Visionen für die weitere Entwicklung und schöne Begegnungen.
Über einen Zukunfts.Dialog, eine Online-Beteiligung über die Landesplattform Vorarlberg.Mitdenken und weitere Formate wurden vielfältige Perspektiven der Bevölkerung des Großen Walsertals eingeholt. In Zentrum standen dabei Fragen zur künftigen Entwicklung des Tals und dem Zusammenleben. Die Ergebnisse dienen der Politik als Anregung für weitere Ausrichtungen mit Blick auf die Überarbeitung des Leitbilds der Region sowie strategisch-operativer Pläne.
Ergebnisse und Wirkungen
- Entwicklung eines agilen Prozessdesigns, das Fragen der Identität, Strukturen, Chancen und Herausforderungen aufnahm Entwicklung und Erprobung neuer Strukturen der Zusammenarbeit mit weiterentwickelten Gremien, operativen Einheiten und Einbeziehung verschiedenster Akteurinnen und Akteure
- Umsetzung verschiedenster Beteiligungsformate für die Bevölkerung
- Aufbau und inhaltliche Erprobung des Begegnungsraums Tal/Studio durch Nutzung eines leerstehenden Hotels Konzeptionierung und Umsetzung der Pilotveranstaltung „Werkstatt fürs Tal“ im Jahr 2022 als Festival für Zukunfts.Gestaltung und Begegnung. 2024 konnte das zweite Festival durchgeführt und ein Beschluss gefasst werden, dass dieses künftig zweijährig stattfinden soll und somit eine kontinuierliche Beteiligungskultur aufgebaut wird.
Erfahrung
Der Prozess „Übergänge gestalten“ nahm die Entwicklung der Region seit der Gründung der REGIO im Jahr 1972 auf und beleuchtete substanziell die Formen und gewachsenen Strukturen der Zusammenarbeit und Kooperation. Das professionelle, neutrale und agile Prozessdesign über einen längeren Zeitraum war essenziell, um Themen von Identitätsfragen bis hin zu gremialen und operativen Feldern zukunftsweisend aufstellen zu können. Scheinbar kleine Herausschälungen wie die Unterscheidung einer politischen Gemeinde und einer Ortschaft im Gemeinschaftssinne waren für die Bearbeitung zentral, um mit den Akteurinnen und Akteuren in grundlegende Verhandlungen gehen zu können. Ebenso wichtig war, dass - neben der strategischen Ebene - über die Koordinatorin für ein gutes Miteinander zeitgleich praktische Impulse und Formate bis hin zur Entwicklung eines neuen Begegnungsortes geschaffen werden konnten. Somit wurde der Prozess für die Bevölkerung direkt spürbar und wirksam und band sie von Anfang an mit ein.