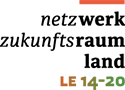Mehrwert Berglandwirtschaft
Ökosystemleistungen in Wert setzen
- Themenbereich
- Land- und Forstwirtschaft inkl. Wertschöpfungskette
- Umwelt, Biodiversität, Naturschutz
- Innovation
- EIP-AGRI
- Klimaschutz und Klimawandel
- Untergliederung
- Landwirtschaft
- Wasser
- Erneuerbare Energie
- Bildung & Lebenslanges Lernen
- Chancengleichheit
- EIP Europäische Innovationspartnerschaft
- Gesundheit
- Innovation
- Klimaschutz
- Klimawandelanpassung
- Kultur
- Lebensmittelverarbeitung
- Luftreinhaltung
- Nahversorgung
- Schutzgebiete
- Wissenstransfer
- Biodiversität
- Naturschutz
- Umweltschutz
- Forstwirtschaft
- Wald
- Boden
- Tierwohl
- Alm- & Berglandwirtschaft
- Vermarktung und Vertrieb
- Nachhaltige Landschaftspflege
- Wertschöpfung
- Kurze Versorgungsketten
- Diversifizierung
- Direktvermarktung
- Tourismus
- Betriebswirtschaft
- Landwirtschaftliche Dienstleistungen
- KMUs, Gewerbe & Wirtschaft
- ÖPUL
- Projektregion
- Oberösterreich
- LE-Periode
- LE 14–20
- Projektlaufzeit
- 06/22-04/25
- Projektkosten gesamt
- 397 186,19
- Fördersumme aus LE 14-20
- 397 186,19
- Massnahme
- Zusammenarbeit
- Teilmassnahme
- 16.2 Förderung für Pilotprojekte und für die Entwicklung neuer Erzeugnisse, Verfahren, Prozesse und Technologien
- Vorhabensart
- 16.02.1. Unterstützung bei der Entwicklung neuer Erzeugnisse, Verfahren & Technologien der Land-, Ernährungs- & Forstwirtschaft
- Projektträger
- ARGE Mehrwert Berglandwirtschaft
Kurzbeschreibung
In der Nationalpark OÖ. Kalkalpen Region gibt es eine sehr naturnahe Form der Berglandwirtschaft. Neben der Lebensmittelproduktion sichert sie wichtige Ökosystemleistungen (ÖSL) wie sauberes Wasser, Kohlenstoffspeicherung und Biodiversität. Letztere werden jedoch selten kostendeckend vergütet. Dadurch ist der Fortbestand der kleinstrukturierten Berglandwirtschaft gefährdet. Ziel ist es deshalb, Landwirtinnen und Landwirten zusätzliche Einkommensquellen durch die Vermarktung gesellschaftlich relevanter ÖSL zu erschließen. Dazu arbeiteten regionale Landwirtinnen und Landwirten und wissenschaftliche Partnerinnen und Partnern zusammen, um die wesentlichen ÖSL der Berglandwirtschaft mithilfe von Indikatoren zu erfassen, betriebswirtschaftlich zu bewerten und marktfähige Geschäftsmodelle zur Inwertsetzung dieser Leistungen zu entwickeln. Durch Befragungen und Workshops wurde zudem das Bewusstsein der Landwirtinnen und Landwirten für die Erbringung dieser ÖSL durch die Berglandwirtschaft gestärkt.Ausgangssituation
In den letzten Dekaden gab es für die regionale Berglandwirtschaft herausfordernde Entwicklungen. Es sind dies: ein zunehmender Rückgang der Bewirtschaftung von Grünland bei sinkenden Großvieheinheit (GVE) Zahlen auf den Betrieben aufgrund der immer schlechteren Rentabilität der Produktion aufgrund der agrarischen Ungunstlage eine zunehmende Arbeitsbelastung auf den Betrieben durch die Notwendigkeit, mehrere Einkommensstandbeine am Betrieb zu etablieren sinkende Produktivität / Einnahmen aus der landwirtschaftlichen Erzeugung und dadurch bedingt steigende Abhängigkeit von öffentlichen Zuschüssen (GAP Reform). Dieses Szenario bedroht sowohl die Berglandwirtschaft direkt als auch die Entwicklung der Region mit ihren weiteren Wirtschaftssektoren, beispielsweise das Ziel, den Tourismus aufzubauen und weiterzuentwickeln als auch die Bereitstellung der öffentlichen Güter.Ziele und Zielgruppen
Die Ziele lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Bessere ökonomische Absicherung der nachhaltigen, ökologischen Berglandwirtschaft Erhebung und Bewertung der Ökosystemleistungen der Berglandwirtschaft der Region Erhebungen von Bedarfen und Möglichkeiten zur Abgeltung von Ökosystemleistungen systematisch ausloten (Wirtschaftsbetriebe und Endabnehmer und Endabnehmerinnen betrachend) Konzeption von Vermarktungsoptionen für das Nicht-Marktgut Ökosystemleistung, was die Entwicklung, Testung und Evaluation innovativer Geschäftsmodelle für Ökosystemleistungen der Berglandwirtschaft inkludiert Wissensweitergabe – Informationen und Bewusstseinsbildung für Ökosystemleistungen sowie Möglichkeiten zu deren Inwertsetzung Zielgruppen: Landwirtinnen und Landwirte in der Berglandregion Industrie und Wirtschaft Konsumentinnen und Konsumenten Tourismus GemeindenProjektumsetzung und Maßnahmen
Im ersten Schritt ging es um das „Erfassen“: es wurde ein Modell zur Beschreibung der Ökosystemleistungen entwickelt, zur qualitativen Beschreibung der Teilaspekte, Abgrenzungen und Zusammenhänge derselben so wie auch eine Definition eines Indikatoren-Sets zur Bewertung der Ökosystemleistungen entsprechend dem Modellansatz erfolgt. Im Zuge einer Feldstudie mit rund 30 Betrieben wurden mit Hilfe der entwickelten Indikatoren die Ökosystemleistungen erhoben und anschließend auf Betriebs- und Regionalebene ausgewertet und analysiert. Diese aufbereiteten Analyseergebnisse stellten die Grundlage für die monetären Bewertungsansätze dar, für die Trends, Potentialabschätzungen und Handlungsalternativen. In Phase II steht das „Bewerten“ im Fokus: hier wurden durch quantitative und qualitative Erhebungen das Erbringungspotential auf den landwirtschaftlichen Betrieben erhoben und die betrieblichen Mehrwerte hinsichtlich Umweltwirkungen und Einkommen durch die Erbringung der Ökosystemleistungen quantifiziert. Weiters erfolgten agrarökonomische Kalkulationen zu den Bereitstellungskosten und Recherchen zu möglichen Vermarktungsmöglichkeiten, zu Bedarfe im Sektor Wirtschaft mit Hinblick auf künftige Rahmenbedingungen. In Phase III ging es um die „In-Wert-Setzung“. Hier fanden mehrstufige empirische qualitative und quantitative Erhebungsverfahren ihre Anwendung, insbesondere mit relevanten Stakeholdern wie Landwirt:innen, Unternehmen, Konsument:innen sowie politischen Vertreter:innen. Auf dieser Basis erfolgte eine Identifikation von Bedarfen und Entwicklung eines Kriterienkataloges für marktfähige neue Geschäftsmodelle. Diese wurden prototypisch für verschiedene Betriebszweige entwickelt und einer Akzeptanzanalyse unterzogen.Ergebnisse und Wirkungen
Der Fokus im Rahmen des EIP-Projektes liegt im Endergebnis in folgenden Bereichen: Vorlage einer wissenschaftlich fundierten Analyse der relevanten Ökosystemleistungen im Umfeld der Berglandwirtschaft in der Nationalparkregion. Vorlage einer datenbasierten Bewertung der Ökosystemleistungen der Berglandwirtschaft. Wissen über die Bereitstellungs- und Opportunitätskosten ausgewählter Ökosystemleistungen der Berglandwirtschaft in der Nationalpark OÖ Kalkalpen Regio. Theoretische Grundlagenarbeit zur konsumenten-/zielgruppentauglichen Kommunikation/Vermittlung als Basis für eine erfolgsversprechende Vermarktung des Gesamtpaketes der Ökosystemleistungen Gemeinsam mit den Betrieben wurden die Grundlagen zur Vermarktung der Ökosystemleistungen erarbeitet. Skalieren der Erkenntnisse auf Ebene der Berglandwirtschaftsbetriebe, indem praktikable Indikatoren, Tools und Verfahren zur betrieblichen Erfassung der relevanten Ökosystemleistungen entwickelt und getestet werden. Abschätzung künftiger gesetzlicher Entwicklungen/betrieblicher Verpflichtungen wie Green Deal und Biodiverstitätsimpact von Unternehmen. Entwicklung potentiell marktfähiger Geschäftsmodelle inklusive Kriterienkatalog zu den Anforderungen der Zielgruppen Prototypentestung und Akzeptanzanalyse. Mittelfristig ein breites Netzwerk von Landwirtinnen und Landwirten, Wissensvermittlerinnen und Wissensvermittlern, Interessensvertreterinnen und Interessensvertretern, Verbänden, Wissenschaft sowie Konsumentinnen und Konsumenten wurde entwickelt.Erfahrung
Aufgrund der Ergebnisse kann festgehalten werden: Es gibt ein vielfältiges Angebot an Biodiversität und Ökosystemleistungen in der Berglandwirtschaft Die Berglandwirtschaft startet mit ihren Leistungen bereits auf einem hohen Niveau Der Erhalt der Biodiversität ist vom einzelnen Betrieb und der Bewirtschaftung abhängig Die Erbringung dieser Biodiversitätleitungen sind erheblen Mehrkosten verbunden. Die Ergebnisse sind wissenschaftlich fundiert und für die Region nachweisbar. Der Green Deal kann als Chance für die neue Einkommensmöglichkeiten gesehen werden. Es zeigt sich aber auch noch weiterer Forschungsbedarf: die Balance zwischen Förderung der Biodiversität und wirtschaftlicher Tragfähigkeit muss gewährleistet werden. Dafür sind staatliche Unterstützung aber auch innovative Finanzierungsansätze aus der Privatwirtschaft erforderlich. Detaillierte Bedarfe hinsichtlich Messbarkeit / Überprüfbarkeit / Zertifizierung müssen noch erhoben werden. Dazu gehören auch die Abklärung von institutioneller, rechtlicher und formaler Bedingungen zur Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle.Pdf-Ausgabe
weitere Bilder
Felix Fößleitner
Josef Wolfthaler
Franz Hörndler
ARGE Mehrwert Berglandwirtschaft