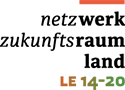Boden.Biodiversität
Entwicklung neuer Anbauverfahren zur Sicherung der mikrobiellen Diversität im Boden und ihrer Funktionen für eine klimafitten und ressourceneffizienten Ackerbau
- Themenbereich
- Land- und Forstwirtschaft inkl. Wertschöpfungskette
- Umwelt, Biodiversität, Naturschutz
- Klimaschutz und Klimawandel
- Innovation
- EIP-AGRI
- Untergliederung
- Landwirtschaft
- Innovation
- Wissenstransfer
- Bildung & Lebenslanges Lernen
- Klimaschutz
- Klimawandelanpassung
- Wasser
- ÖPUL
- Biodiversität
- Umweltschutz
- Luftreinhaltung
- Nachhaltige Landschaftspflege
- Boden
- EIP Europäische Innovationspartnerschaft
- Projektregion
- Niederösterreich
- LE-Periode
- LE 14–20
- Projektlaufzeit
- 01.01.2022-31.12.2024
- Projektkosten gesamt
- 437529,70
- Fördersumme aus LE 14-20
- 437529,70
- Massnahme
- Zusammenarbeit
- Teilmassnahme
- 16.1 Förderung für die Einrichtung und Tätigkeit operationeller Gruppen der EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit"
- Vorhabensart
- 16.01.1. Unterstützung beim Aufbau & Betrieb operationeller Gruppen der EIP für lw. Produktivität & Nachhaltigkeit
- Projektträger
- LK Niederösterreich
Kurzbeschreibung
Im Projekt „Boden.Biodiversität“ werden die Auswirkungen verschiedener Ackerbaumaßnahmen auf die Biodiversität des Bodenlebens untersucht. Daraus entstehen praxisnahe Empfehlungen, die Landwirt:innen einfach in ihre Betriebe integrieren können, um Bodenfruchtbarkeit und Artenvielfalt zu fördern.Untersucht werden Teilflächen auf Betrieben der operationellen Gruppe sowie langjährige Bodenbearbeitungsversuche an zwei landwirtschaftlichen Fachschulen. Ergänzend erfolgen Vegetationsmessungen per Drohne, um digitale Methoden zu erproben.
Zielgruppen sind vor allem praktizierende Landwirt:innen, Berater:innen sowie Lehrkräfte und Schüler:innen landwirtschaftlicher Schulen.
Ausgangssituation
Im Ackerbau zeigt sich seit Jahren ein marktbedingter Trend zu vereinfachten Fruchtfolgen: Wenige Kulturen dominieren, etwa Winterweizen, Wintergerste und Körnermais mit rund 43 % der österreichischen Ackerfläche (Grüner Bericht 2020).Studien belegen jedoch, dass vielfältige Anbausysteme die Ertragsstabilität gegenüber klimabedingten Risiken wie Hitze, Trockenheit oder Starkregen erhöhen und zugleich die Einkommenssicherheit in Betrieben stärken. Innovative, standortangepasste Fruchtfolgen können somit wesentlich zur Stabilität der Pflanzenproduktion beitragen.
Die Vorteile liegen im engen Zusammenhang von Pflanzendiversität, mikrobieller Vielfalt und Bodenfruchtbarkeit: Mehr Pflanzenarten fördern Biomasse, Vielfalt und Aktivität von Bodenmikroorganismen und verbessern zentrale Ökosystemleistungen wie CO₂-Bindung und geschlossene Nährstoffkreisläufe.
Noch fehlen jedoch praxistaugliche Konzepte, wie biodiversitätsfördernde Anbausysteme effektiv umgesetzt werden können. Hier setzt das Projekt an: Gemeinsam mit innovativen Praxisbetrieben des Vereins Boden.Leben sowie angewandter und grundlagenorientierter Forschung werden Strategien entwickelt, um Biodiversität und Bodengesundheit in der österreichischen Landwirtschaft gezielt zu stärken.
Ziele und Zielgruppen
Ziel des Projekts ist es, Anbausysteme zu entwickeln, die die positiven Effekte mikrobieller Vielfalt im Boden nutzen. Dadurch sollen Ackerböden gesünder und widerstandsfähiger gegenüber den Herausforderungen des Klimawandels werden.Dafür kombiniert das Projekt Praxis- und Exaktversuche mit modernen Methoden: DNS-Sequenzierung zur Analyse der Bodenmikrobiologie, Messungen zentraler Bodengesundheitsindikatoren (z. B. Enzymaktivität, organische Substanz, Bodenstruktur) sowie Fernerkundung zur Erfassung der Pflanzenvitalität.
Das Ergebnis soll praxisnahe Leitlinien und Werkzeuge liefern, die Landwirtinnen, Beraterinnen und Behörden bei der Umsetzung biodiverser, bodenverbessernder Anbausysteme unterstützen – für mehr Bodenfruchtbarkeit und ökologische Leistungsfähigkeit im Ackerbau.
Projektumsetzung und Maßnahmen
Im Projekt werden auf Teilflächen von sechs Betrieben der operationellen Gruppe mehrmals jährlich Bodenproben genommen. Die Betriebe bewirtschaften ihre Flächen in üblicher Fruchtfolge, legen jedoch kleine Teilflächen mit abweichenden Anbauweisen an. Zusätzlich werden langjährig bodenaufbauend bewirtschaftete Flächen mit angrenzenden, zuvor konventionell genutzten Neupachtflächen verglichen, um die Auswirkungen unterschiedlicher Bewirtschaftungsformen auf die Bodenbiodiversität zu untersuchen.An den landwirtschaftlichen Fachschulen in Hollabrunn (Trockengebiet) und Pyhra (Feuchtgebiet) werden langjährige Bodenbearbeitungsversuche analysiert. Dort stehen verschiedene Begrünungsvarianten im Fokus: Schwarzbrache, eine betriebsübliche wenig artenreiche Zwischenfruchtmischung, eine biodiversere Mischung sowie Ackergrasstreifen.
Mittels Drohnen und Spektralmessungen wird erfasst, wie sich biodiversitätsfördernde Maßnahmen im Boden auf die Vegetation der Kulturpflanzen auswirken.
Ergebnisse und Wirkungen
ProjektergebnisseFeldbodentests zur Diagnose und Bewertung der Bodengesundheit (Struktur, Biologie) durch Landwirtinnen und Beraterinnen wurden evauliert und in einem Factsheet inklusive Anleitungen abgebildet.
Aus den Ergebnissen ergab sich, dass vor allem die Maßnahmen Zwischenfruchtanbau und reduzierter Bodeneingriff große Hebel sind, welche die Betriebe integrieren können um die Biodiversität im Boden zu fördern.
Durch den Anbau von Begrünungen, in Zeiten wo sonst keine Pflanzen auf dem Acker stehen würden, kann man die Mikroorganismen durch gezieltes Füttern mit Wurzelausscheidungen fördern.
Durch die Reduktion oder das völlige Weglassen der Bodenbearbeitung profitieren die Mikroorganismen im Boden auch stark, da sie weniger gestört werden und sich so besser entfalten und vermehren können.
Alle Ergebnisse sind in den auf der Projekthomepage zum Download verfügbaren Berichten zu finden.
Erfahrung
Ein Projektzeitraum von nur drei Jahren ist viel zu kurz für zu bearbeitende Themen wie sie es in diesem Projekt waren. Der Boden braucht viel mehr Zeit um sich an ein anderes Bewirtschaftungssystem anzupassen und so waren die meisten messbaren Ergebnisse nur auf den zusätzlich integrierten Langzeitversuchen auf den Standorten der Fachschulen in Hollabrunn und Pyhra zu finden.Hinzu kommt, dass wenn die Versuchsbetriebe mit Feldversuchen auf Risiko der Nichtgenehmigung nicht schon im Sommer 2021 begonnen hätten, hätte das Projekt eine ganze Ernte versämt um Ergebnisse zu erhalten.