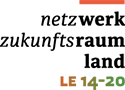Weide-Innovationen
- Themenbereich
- Land- und Forstwirtschaft inkl. Wertschöpfungskette
- Innovation
- EIP-AGRI
- Untergliederung
- Landwirtschaft
- Wissenstransfer
- Innovation
- EIP Europäische Innovationspartnerschaft
- Projektregion
- Niederösterreich
- Oberösterreich
- Salzburg
- Steiermark
- Tirol
- LE-Periode
- LE 14–20
- Projektlaufzeit
- 01.01.2022-31.12.2024 (geplantes Projektende)
- Projektkosten gesamt
- 493.525,44
- Fördersumme aus LE 14-20
- 493.525,44
- Massnahme
- Zusammenarbeit
- Teilmassnahme
- 16.1 Förderung für die Einrichtung und Tätigkeit operationeller Gruppen der EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit"
- Vorhabensart
- 16.01.1. Unterstützung beim Aufbau & Betrieb operationeller Gruppen der EIP für lw. Produktivität & Nachhaltigkeit
- Projektträger
- DIin Veronika Edler
Kurzbeschreibung
Seit einigen Jahren nimmt das Interesse an der Weidehaltung stetig zu. Ausschlaggebend dafür sind unter anderem neue gesetzliche Vorgaben, Anforderungen des Marktes, gesellschaftlicher Druck. Viele Bio-Betriebe sind aufgrund der neuen Weidevorgaben gezwungen, Flächen in die Beweidung zu nehmen, die nur bedingt für die Beweidung geeignet sind. Im Projekt „Weide-Innovationen“ wird auf Praxisbetrieben untersucht, welche Pflanzenbestände und Weidestrategien für die Beweidung von kleinen Flächen mit einer höheren Anzahl an Tieren, von Hutweiden und Steilflächen, von Flächen im Trockengebiet und zur Senkung des Parasitendruckes auf Schaf- und Ziegenweiden geeignet sind. Weiters wird eruiert, welche Aspekte (Management, Wirtschaftlichkeit) für die Weidehaltung von kälberführenden Milchkühen maßgeblich sind. Die Erkenntnisse aus dem Projekt sollen die Betriebe unterstützen, die Ertragsfähigkeit der Weidebestände und somit die Wirtschaftlichkeit ihrer Betriebe langfristig zu sichern.
Ausgangssituation
Durch den Trend zu mehr Weidehaltung und die verschärften gesetzlichen Vorgaben für Bio-Betriebe werden zukünftig hofnahe Weideflächen stärker bestoßen werden. Es ist auch anzunehmen, dass Flächen auf Grenzertragsstandorten wie Hutweiden und Steilflächen sowie Ackerflächen verstärkt in die Beweidung genommen werden. Herausfordernd ist nach wie vor die Weidehaltung von Kleinwiederkäuern, die eine Überempfindlichkeit gegenüber Weideparasiten wie den Roten Magenwurm zeigen. Auswirkungen des Klimawandels mit vermehrten Hitze- und Trockenperioden erschweren das Grünlandmanagement auf Wiederkäuer haltenden Betrieben zusätzlich. Derzeit sind noch keine Saatgutmischungen für Flächen, die stark bestoßen werden, für Flächen in Trockenregionen oder mit antiparasitär wirkenden Pflanzen im Handel erhältlich. In der Praxis werden auch neue Empfehlungen für die Etablierung der Saatgutmischungen im Bestand sowie für eine angepasste Weideführung der Tiere benötigt. Wichtig ist eine standortangepasste Bewirtschaftung, damit keine negativen Effekte auf Boden, Tier und Mensch entstehen. Besonders unter schwierigen Betriebsbedingungen, wie wenig Weidefläche, Steilflächen und Hutweiden, Flächen im Trockengebiet sowie Ackerflächen, Weidehaltung von kleinen Wiederkäuern braucht es nachhaltige und innovative Lösungsansätze, welche auf das derzeitige Wissen aufbauen aber auch darüber hinausgehen. Zukunftsorientiertes Weidemanagement verlangt auch den Einsatz von neuen Techniken. Diese können die Weidehaltung sinnvoll unterstützen (moderne Zäune, Wasserstellen, Schattenspender). Vermehrt wird auf Milchviehbetrieben, insbesondere auf Bio-Betrieben, die kuhgebundene Aufzucht von Kälbern umgesetzt. Diese naturnahe Kälberaufzucht rückt zunehmend in den Fokus des Marktes. Für diese Aufzuchtform liegen einige wenige Beratungsunterlagen und wissenschaftliche Erkenntnisse zur Stallhaltung vor. Zur Weidehaltung von kälberführenden Milchkühen gibt es keine gesammelten Erfahrungen. Um eine breitere Zustimmung für diesen neuen Ansatz der Kälberaufzucht zu finden, werden weiterführende Erkenntnisse zum Weidemanagement und zum ökonomischen Nutzen benötigt. Ein Austausch in einer Stable School und die Erhebung von Praxiswissen auf Best Practise Betrieben sollen zusätzlich zu den Erkenntnissen aus den wissenschaftlich begleiteten Praxisversuchen neues Wissen generieren und nachfolgend für Praxisbetriebe und für die Beratung zur Verfügung stehen.
Ziele und Zielgruppen
Das Projekt „Weide-Innovationen“ verfolgt folgende Ziele: 1) Neues Wissen zur Weidehaltung unter schwierigen Bedingungen in die Praxis bringen. 2) Die Ertragsfähigkeit von Weidebeständen langfristig erhalten und aufbauen. 3) Die Weidehaltung von Kleinwiederkäuern sowie von kälberführenden Milchkühen forcieren. 4) Weidehaltung mit neuen technischen Lösungen erleichtern. 5) Bäuerinnen und Bauern sowie Beraterinnen und Berater vernetzen, um so voneinander zu lernen. Die Hauptzielgruppen sind Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter, die zukünftig Wiederkäuern auch unter schwierigen betrieblichen Bedingungen den Zugang zur Weide ermöglichen wollen sowie Beraterinnen und Berater, die als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ihr Wissen an Praxisbetriebe weitergeben. Für Schülerinnen und Schüler an den landwirtschaftlichen Schulen können die Projektergebnisse einen interessanten Impuls für die Bewirtschaftung des elterlichen Hofs bzw. die Ausrichtung nach der Hofübernahme liefern.
Projektumsetzung und Maßnahmen
Die Operationelle Gruppe setzt sich zusammen aus: - Landwirtschaftlichen Betrieben aus OÖ, S, T, NÖ - BIO AUSTRIA Bundesverband (Lead) und BIO AUSTRIA Landesverbände (NÖ & Wien, S, T) - Landwirtschaftskammer Österreich und Landeskammern (Stmk, NÖ, OÖ) - Österreichischer Bundesverband für Schafe und Ziegen - Studia Schlierbach Als strategische Partner sind die Raumberg-Gumpenstein Research & Development, die Universität für Bodenkultur, die veterinärmedizinische Universität Wien, die Kärntner Saatbau, die Raiffeisenware Austria und 16 Praxisbetriebe als Dienstleister sowie zwei Institute der HBLFA Raumberg-Gumpenstein in das Projekt eingebunden. Im Projekt werden folgende Maßnahmen umgesetzt: 1) Prüfung von speziellen Saatgutmischungen mit jeweils zwei Etablierungsverfahren auf Praxisbetrieben (auf kleinen, stark bestoßenen Flächen im Trockengebiet und in einer niederschlagsreicheren Region) 2) Anlage eines Parzellenversuches auf einem Praxisbetrieb mit simulierten Mob Grazing im Trockengebiet und eines Praxisversuches zur Weidehaltung auf Ackerflächen 3) Erhebung Ist-Bestand auf fünf Praxisbetrieben mit Hutweiden und Steilflächen, Erstellung und Umsetzung von standortangepassten Weidekonzepten, Evaluierung Entwicklung Pflanzenbestand 4) Erhebung und Darstellung von neuen technischen Lösungen zur Erleichterung der Weidehaltung 5) Initiierung einer Stable School mit Praxisbetrieben zum Thema „Bewegungsweide“ inklusive Aufbereitung der Erkenntnisse für die Praxis. 6) Prüfung von speziellen Saatgutmischungen mit antiparasitär wirkenden Pflanzen auf Kleinwiederkäuerweiden (Schafe und Ziegen), Beweidungssystem „Top Grazing“ 7) Erhebung von Praxiswissen zur Weidehaltung auf Kleinwiederkäuerbetrieben 8) Online-Erhebung zu den Erfahrungen mit kuhgebundener Kälberaufzucht (mit und ohne Weide), Eruierung möglicher Problemfelder und exakte Prüfung eines Problemfeldes auf Praxisbetrieb 9) Gegenüberstellung von wirtschaftlichen Kennzahlen bei kuhgebundener Kälberaufzucht mit Weide mit herkömmlichen Aufzuchtsystemen 10) Erstellung von Fachbroschüren und eines Fachvideos (Technik) zu den einzelnen Maßnahmen 11) Erstellung eines eigenen Homepage-Portals zur Verbreitung der Ergebnisse 12) Workshops auf den Pilotbetrieben zur Weitergabe des gewonnenen Wissens an interessierte Praktikerinnen und Praktiker und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.
Ergebnisse und Wirkungen
Nach erfolgeichem Abschluss des Projektes liegen nun zahlreiche Ergebnisse vor, die gesammelt in Broschüren und Foliensätzen frei verfügbar sind. Ein Auszug der Erkenntnisse folgt hier: Eine regelmäßige Nachsaat neu angelegter, intensiv betretener Weideflächen mit speziell geeigneten Mischungen ist zu empfehlen. Neben den klassischen Arten für intensive Weidesysteme (englisches Raygras, Wiesenrispe und Weißklee) können auf diesen Weideflächen weitere ausläufertreibende und stark trittverträgliche Gräserarten wie Rotschwingel und Rotstraußgras zum Einsatz kommen. Der Einsatz von speziellen Weidemischungen für intensiv betretene Weideflächen ist möglich und sinnvoll. Es wird eine Mischung der beiden ÖAG Weidemischungen „KWEI“ und „Dauerweide H“ im Verhältnis 50:50 mit einer Saatstärke von 26 kg/ha empfohlen. Die Mischung stellt sicher, dass sowohl die Futterqualität hochgehalten wird als auch besonders trittverträgliche Arten etabliert werden. Auch intensiv betretene Weideflächen brauchen eine regelmäßige Weidepflege. Die beweidete Fläche ist zu Beginn der Weideruhe abzuschleppen. Sollten unerwünschte Pflanzen vermehrt auftreten, ist auf jeden Fall vor der Versamung eine Pflege durchzuführen. Nach Möglichkeit sollte in der Weideperiode zumindest einmal eine Weideruhe mit Zwischennutzung angestrebt werden. Dafür ist jedoch eine entsprechend große Ausweichfläche notwendig. Die Beweidung von Ackerflächen ist sowohl am trockenen als auch am feuchten Standort gut möglich. Am sehr trockenen Standort des Bio-Betriebes in Aderklaa (NÖ) zeigte die Beimischung Spitzwegerich und Chicorée einen ertragssteigernden Effekt. Der Mengenertrag (TM-Ertrag) war im Vergleich zum Vorjahr um 36 % und der Rohprotein-Ertrag (XP-Ertrag) um 27 % erhöht. Der Pflanzenbestand eignet sich für die Beweidung von Mutterkühen und Mastrindern nach der Weidestrategie „Mob Grazing“. Die Etablierung des Bestandes erfolgte ohne Bewässerung. Am feuchteren Standort des Bio-Milchviehbetriebes in Arnreit (OÖ) wurde die Möglichkeit einer Untersaat von beweidungsfähigen Mischungen in Wintergetreide getestet und mit einer Reinsaat verglichen. Bei der Ernte des zweiten Aufwuchses im Folgejahr der Anlage konnte hinsichtlich des Ertrags kein Unterschied zwischen der als Untersaat und der als Reinsaat angesäten Varianten festgestellt werden. Für das Weidesystem „Mob-Grazing“ braucht es intelligente technische Systeme oder mehr Zeit zum Vorstecken und ein ausgeklügeltes Tränke- und Triebwegsystem. Ruhezeit ist wichtig, egal welches Weidesystem / Weidestrategie ein Betrieb umsetzt! Entscheidend ist auch der angepasste Pflanzenbestand! Um die Entstehung von Viehsteigen zu verhindern, empfiehlt sich die Umsetzung eines Koppelweidesystems mit 5 bis 10 Koppeln, wobei Ruhezeiten von 2 bis 3 Wochen und Besatzzeiten von 3 bis 4 Tagen eingehalten werden sollten. Die Planung der Koppeln sollte sich an den natürlichen Gegebenheiten orientieren, wie sie auf der Hofkarte ersichtlich sind. Dabei ist auf die Einrichtung geeigneter Triebwege und Wasserstellen zu achten. Ab einer Hangneigung der Steilstufe 3 und auf besonders empfindlichen Böden lässt sich die Bildung von Viehsteigen häufig nur durch einen Wechsel mit Schnittnutzung, also im Rahmen eines Mähweidesystems, vermeiden. Im Projekt konnte sich nur die Weide-Zichorie (Sorte: Antlers) in beinahe allen Flächen innerhalb von 3 Jahren mittels Übersaat etablieren. Auf frischeren Standorten auch der Spitz-Wegerich (Sorte: DIVERSITY). Die Nachsaatmischung NAWEI, sowie die Leguminosen Luzerne und Esparsette zeigten keine rasche Durchsetzungskraft in den bestehenden Beständen. Ausnahme bei den Leguminosen ist der Hornklee auf trockenen Standorten. Die Bestoßdauer nimmt großen Einfluss auf ausgeübten Weidedruck. Diese ist kurz zu halten, um die Grasnarbe zu schonen. Weidedauer nicht gut Willens ausdehnen Die Methode der „Stable School“ hat sich für den Austausch und die Lösung von Problemstellungen zu einem bestimmten Thema als sehr funktionstüchtig und praxisnah erwiesen, die von den Teilnehmenden sehr gut angenommen wird. Die Qualität und der mögliche Nutzen der Hofgespräche steigen mit der Vertrautheit der Personen in der Gruppe. Eine effiziente Gruppengröße scheint mit 6-10 Personen erreicht zu sein. Standort und Weideform beeinflussen sich stark gegenseitig Top Grazing am feuchten Standort erhöhte den Parasitendruck. Bei Kurzrasenweide konnte der Boden besser abtrocknen, was den Parasitendruck reduziert hat. Auch führt mehr UV Strahlung bei niedrigem Aufwuchs zu einer stärkeren Reduktion der Parasitenbelastung auf der Weide Das System Kurzrasenweide ist wenig arbeitsintensiv, benötigt jedoch ein hohes Maß an Management und Know-how: das Futterangebot auf der Weide muss regelmäßig überprüft und an den Bedarf der Herde angepasst werden. Ergänzungsflächen müssen zwischenzeitig geerntet werden. Die Wasserversorgung ist wegen der größeren Flächen leichter möglich. Verdichtete Stellen, an denen sich das Vieh häufig aufhält (Leger) entstehen weniger oft, weil die Tiere sich verteilen können. Im Herbst ist nicht immer zwingend ein Reinigungsschnitt notwendig. Der hohe Weidedruck in Verbindung mit dem tiefen Verbiss fördert eine erhöhten Parasitenbelastung. Zugleich ist aber die Grasnarbe bis zum Boden offen und der Boden kann gut abtrocknen. Zusätzlich schädigt das bis auf den Boden vordringende UV-Licht die Larven der Parasiten. Die Form des Top Grazing stellt hohe Anforderungen an das Management. Um hohe Arbeitskosten bei der Rotation der Herde zu vermeiden und eine zuverlässige Wasserversorgung zu gewährleisten, muss eine entsprechende fixe Infrastruktur aufgebaut werden. Eine Reduktion der Parasitenbelastung ist nur an trockenen Standorten möglich. Auf feuchten Standorten hingegen fördert die dauerhafte Bodendeckung die Feuchtigkeit im Boden, was die Entwicklung der Parasiten-Larven begünstigte. Die Broschüren und Foliensätze enthalten alle weiteren Egebnisse und sind unter anderem auf der Homepage von BIO AUSTRIA unter https://www.bio-austria.at/bio-bauern/beratung/tierische-erzeugung/projekt-eip-weide-innovationen/ zu finden.
Erfahrung
Die Umsetzung des Projektes verlangte von allen Mitwirkenden ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit. Da alle Versuche im Freien durchgeführt werden, trägt die Witterung wesentlich zum Gelingen bei. Eine Kältephase im Frühjahr im ersten Versuchsjahr verzögerte die Keimung der Saatgutmischungen und die darauffolgende Trockenheit minderte das Pflanzenwachstum. Rückblickend gesehen, können diese Beeinträchtigungen nicht vorausgeplant werden. Es waren zusätzliche kurzfristige Abstimmungen und intensivere Beobachtungen notwendig, um die Versuche wie geplant umzusetzen. Der hohe Motivationsgrad aller Beteiligten hat wesentlich zum Gelingen beigetragen.