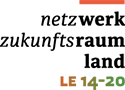ARGE Streifenanbau
Agrarökologische und -ökonomische Untersuchung des Systems STREIFENANBAU und Entwicklung von Leitlinien für die Praxis
- Themenbereich
- Land- und Forstwirtschaft inkl. Wertschöpfungskette
- Umwelt, Biodiversität, Naturschutz
- Innovation
- EIP-AGRI
- Untergliederung
- Landwirtschaft
- Naturschutz
- Nachhaltige Landschaftspflege
- Klimawandelanpassung
- EIP Europäische Innovationspartnerschaft
- Innovation
- Wissenstransfer
- Biodiversität
- Umweltschutz
- Betriebswirtschaft
- Boden
- Risikomanagement
- Projektregion
- Burgenland
- Niederösterreich
- Oberösterreich
- LE-Periode
- LE 14–20
- Projektlaufzeit
- 01.02.2022-31.01.2025
- Projektkosten gesamt
- 469563,64
- Fördersumme aus LE 14-20
- 255292,88
- Massnahme
- Zusammenarbeit
- Teilmassnahme
- 16.2 Förderung für Pilotprojekte und für die Entwicklung neuer Erzeugnisse, Verfahren, Prozesse und Technologien
- Vorhabensart
- 16.02.1. Unterstützung bei der Entwicklung neuer Erzeugnisse, Verfahren & Technologien der Land-, Ernährungs- & Forstwirtschaft
- Projektträger
- ARGE Streifenanbau
Kurzbeschreibung
Die Idee hinter Streifenanbau liegt darin, durch eine kleinräumigere Ackerbewirtschaftung in Streifenform sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile zu erreichen. Durch Streifenanbau soll ein attraktiveres Habitat für Insekten geschaffen werden, Bodenerosion vorgebeugt und das Auftreten von Krankheiten und Schädlinge in den Ackerkulturen durch natürliche Gegenspieler reduziert werden. Gleichzeitig soll durch die Wahl einer passenden Streifenbreite die Bewirtschaftung mit üblichen Landmaschinen beibehalten werden können, sodass die Umsetzung für Landwirt:innen möglichst kostengünstig bleibt. Im Rahmen dieses Projekts wurde das Ackerbausystem Streifenanbau hinsichtlich mehrerer ökologischer und ökonomischer Faktoren untersucht und weiterentwickelt. Des Weiteren wurden die Erkenntnisse laufend in Projektveranstaltungen, externen Fachveranstaltungen, Fachartikeln und durch eine Broschüre „Leitlinien für die Praxis" an Landwirt:innen und andere interessierte Gruppen vermittelt.Ausgangssituation
Drei Bio-Landwirte aus Oberösterreich - Christian Stadler, Rudolf Hofmann und Gerhard Weißhäupl - haben, wie viele andere Menschen in Österreich, beobachtet, dass immer weniger Insekten in unserer Landschaft vorkommen, Landmaschinen und in weiterer Folge auch Feldstücke immer größer werden und Starkregenereignisse und damit einhergehende Bodenerosion einen negativen Einfluss auf Ackerbaubetriebe und Natur haben. In den Niederlanden wurde zu diesem Zeitpunkt bereits mit Streifenanbau experimentiert und von der Universität Wageningen dazu geforscht. Die drei Landwirte wollten herausfinden, ob dieses System auch in Österreich zur Bewältigung beziehungsweise Eindämmung aktueller Herausforderungen im Ackerbau dienen kann und möglicherweise zum Ackerbausystem der Zukunft werden könnte. Durch die Initiierung des Streifenanbauprojekts sahen die drei Landwirte eine Chance als Praktiker gemeinsam mit Wissenschaftler:innen und anderen Organisationen an einer womöglich zukunftsweisenden Ackerbaumethode zu forschen, so die Landbewirtschaftung weiterzuentwickeln und vielleicht sogar der fortschreitenden Entwicklung monotoner Agrarlandschaften der letzten Jahrzehnte entgegenzuwirken. Gleichzeitig sah man großes Potential, durch Krankheits- und Schädlingseindämmung und positiver Randeffekte im Bio-Ackerbau durch Streifenanbau auch Mehrerträge lukrieren zu können und so mit dem Streifenanbau auch möglicherweise ein wirtschaftlicheres Ackerbausystem gefunden zu haben.Ziele und Zielgruppen
Das Ziel des Projekts war es, agrarökologische und -ökonomische Untersuchung zum System Streifenanbau durchzuführen, einen Vergleich des Systems mit den gleichen Fruchtfolgegliedern im flächigen Anbau herzustellen und praxistaugliche Erkenntnisse festzuhalten. Folgende Teilziele wurden definiert: Evaluierung des Innovationspotentiales des Streifenanbausystems im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit des Systems, Stabilität und Resilienz der Ackerkulturen, Qualität der Erntefrüchte und die Gesundheit der Ackerkulturen im Streifenanbau Untersuchung der Auswirkungen auf die Stabilität und Resilienz der Ackerkulturen, Qualität der Erntefrüchte und die Gesundheit der Ackerkulturen im Streifenanbau Untersuchung der Auswirkungen des Streifenanbaus auf die vorhandene Artenvielfalt der Insekten auf den Ackerflächen, die Bodenfruchtbarkeit und das Aufkommen von Unkräutern,.. Entwicklung von geeigneten und praxistauglichen Managementstrategien für den Streifenanbau Austausch zwischen Beratung, Forschung und Praxis: In der Projektphase werden die Ergebnisse auch mit Fachkolleginnen und -kollegen von Universitäten, Beratung und Praxis diskutiert und evaluiert Die Zielgruppe für das Projekt waren vorwiegend Landwirt::innen, Berater::innen sowie Interessierte Menschen aus dem agrarischen Umfeld.Projektumsetzung und Maßnahmen
Zur Erreichung der Projektziele, wurden im Rahmen des Projekts folgende Maßnahmen in Form diverser Arbeitspaketen umgesetzt: Datenaufnahme am Streifenanbaufeld und den Vergleichsflächen: Nützlingsmonitoring, Ertrags- und Qualitätserfassung, Dokumentation des Arbeitsaufwands in der Bewirtschaftung sowie diversen Bestandsbonituren Sammlung von Erfahrungen aus der Bewirtschaftung und fachlicher Austausch mit Demonstrationsbetrieben und Wissenschaftlern zur Entwicklung diverser Handlungsempfehlungen im Bezug auf Streifenanbau Organisation diverser Veranstaltungen zur Vermittlung der gewonnenen Erkenntnisse an Praktiker:innen und Interessierte sowie zum fachlichen Austausch untereinander Erstellen und Veröffentlichen von Informationsmaterialien in Form von Artikeln in agrarischen Fachmagazinen, einem Info-Folder, einer Homepage sowie einer Broschüre als praktische Anleitung für Landwirt::innen. Vorbereiten und Abhalten von Vorträgen bei externen Fachveranstaltungen über das Projekt und allgemein zum Thema Streifenanbau An der Projektumsetzung waren die Operationelle Gruppe (Christian Stadler, Gerhard Weißhäupl, Rudolf Hofmann und Bio Austria), Dr. Ronnie Walcher von der Universität für Bodenkultur Wien, Daniel Lehner von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein, vier Demonstrationsbetriebe aus Oberösterreich, Niederösterreich und dem Burgenland und die Projektkoordinatoren Julia Kammerhuber und Hans-Georg Graf beteiligt.Ergebnisse und Wirkungen
Im Allgemeinen hat das Streifenanbauprojekt mit Sicherheit dazu beigetragen, dass dieses Anbausystem mehr Bekanntheit unter Österreichs Landwirt:innen erfährt und generell an Relevanz dazugewonnen hat. In Anbetracht des stark sinkenden Feldvögel- und Insektenvorkommen in den österreichischen Ackerlandschaften besteht klarer Handlungsbedarf. Ein Schritt in Richtung ökologischer Konservierung wäre nun nachweislich mit der vermehrten Umsetzung von Streifenanbau möglich – gerade in intensiven Ackerbauregionen bzw. strukturärmeren Landschaften. Bei den gängigen Ackerkulturen gingen die Ergebnisse innerhalb des Projekts hinsichtlich Mehr- oder Mindererträgen etwas auseinander: Auf der Fläche in Hofkirchen im Traunkreis kam es im Streifenanbau aus mehreren Gründen im Durchschnitt zu niedrigeren Erträgen als im ganzflächigen Anbau. Einige Demonstrationsbetriebe haben hingegen im Laufe des Projekts von wesentlich höheren Erträgen aus den Streifenanbaukulturen berichtet. Erfahrungen aus einem Streifenanbauprojekt in der Schweiz zeigen ebenfalls Zwischenergebnisse in beide Richtungen. In niederländische Publikationen zum Streifenbau wird wiederum berichtet, dass bei den gängigen Ackerkulturen normalerweise zumindest gleich hohe Erträge wie im ganzflächigen Anbau erreicht werden sollten. Es besteht aus Sicht der Projektgruppe noch klares Forschungspotential. Vor allem hinsichtlich Kulturartenkombinationen. Gerade bei Gemüsekulturen, könnte es bei weiteren Streifenanbauversuchen zu interessanten Ergebnissen kommen. Des Weiteren wären die Auswirkungen von Streifenanbau auf weitere Insektenarten und Feldvögel interessant. Streifenanbau bietet als Anbausystem jedenfalls noch Weiterentwicklungspotential.Erfahrung
Gerade für Bio-Gemüsebauern kann Streifenanbau nach Einschätzungen der Projektgruppe in vielen Fällen eine wirtschaftliche Alternative sein: geringerer Krankheitsdruck und kostengünstige Ausbringung von Transfermulch sprechen dafür. Der Demonstrationsbetrieb Gumpelmeier hat im Laufe des Projekts gezeigt, welcher Erfolg sich dabei erzielen lassen. Eine stichhaltige Zusammenfassung der praxistauglichen Erkenntnisse aus dem Projekt wurde auch mit den „Leitlinien zur praktischen Umsetzung“ veröffentlicht. Aus der Arbeit im Projekt wurde uns grundsätzlich klar, dass in der Projektplanung im Vorfeld, es besonders wichtig ist, das richtige Maß an klar definierten Maßnahmen/Zuständigkeiten und Flexibilität in der Umsetzung zu finden. Es es kann im Zuge der Projektlaufzeit, vor allem bei komplexeren Vorhaben, auch zu unerwarteten Ereignissen kommen, was eine gewisse Flexibilität und Anpassungsfähigkeit erfordert. Im Nachhinein betrachtet, wäre eine noch intensivere Einbindung von noch mehr Demonstrationsbetrieben bzw. Versuchslandwirt::innen sicherlich von Vorteil für den Erkenntnisgewinn gewesen.Pdf-Ausgabe
weitere Bilder
Morgentau Biogemüse Gmbh
Morgentau Biogemüse Gmbh
Morgentau Biogemüse Gmbh
Morgentau Biogemüse GmbH