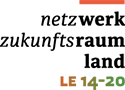Rollen im Wandel
- Themenbereich
- Basisdienstleistungen, Leader, Gemeinden
- Untergliederung
- Chancengleichheit
- Frauen
- Gender
- Jugend
- LEADER
- Projektregion
- Vorarlberg
- Lokale Aktionsgruppe
- LAG REGIO-V Regionalentwicklung Vorarlberg
- LE-Periode
- LE 14–20
- Projektlaufzeit
- 27.01.2022-31.10.2024
- Projektkosten gesamt
- 124 714,08 €
- Fördersumme aus LE 14-20
- 74 828,45 €
- Massnahme
- Förderung zur lokalen Entwicklung (CLLD)
- Teilmassnahme
- 19.2. Förderung für die Durchführung der Vorhaben im Rahmen der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategie für lokale Entwicklung
- Vorhabensart
- 19.2.1. Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie
- Projektträger
- Regionalentwicklung Vorarlberg eGen
Kurzbeschreibung
Mädchen auf dem Skaterplatz, ein Steuerberater als Tagesvater und eine Mutter als Obfrau des Fußballvereins: Das gibt es in Vorarlberg noch wenig. Dabei können anders verteilte Rollen und die Auflösung von Geschlechterrollenbildern für die Einzelperson, gesellschaftlich und wirtschaftlich von Nutzen sein, beispielsweise durch zufriedenere Eltern und ausgebildete Frauen, die als Fachkräfte zur Verfügung stehen oder lebendige Vereine, in denen sich unterschiedlichste Menschen für den Lebensraum engagieren. Das Projekt „Rollen im Wandel“ wollte diese Potenziale nutzbar machen, holte Alternativen zur herkömmlichen Rollenverteilung vor den Vorhang und lud dazu ein, diese auszuprobieren. Hierfür boten das femail, der Vorarlberger Familienverband und der Verein Amazone mit Unterstützung der Regionalentwicklung Vorarlberg vielfältige Angebote wie Buchvorstellungen, einen Podcast und Workshops.
Ausgangssituation
In Vorarlberg überwiegt das Modell der traditionellen Rollenteilung: Gemäß dem Vorarlberger Gleichstellungsbericht 2021 beziehen im österreichweiten Vergleich in Vorarlberg am wenigsten Männer Kinderbetreuungs- oder Karenzgeld und Frauen sind wesentlich häufiger „atypisch“ beschäftigt. In Vorarlberg waren 2019 insgesamt 71,6 Prozent der Frauen beschäftigt, davon 51,1 Prozent in Teilzeitbeschäftigung mit einem durchschnittlichen Arbeitsaufwand von rund 20 Stunden pro Woche. Frauen begründen Teilzeit vor allem mit der Betreuung von Kindern oder zu pflegenden Angehörigen sowie mit Aus- und Weiterbildungszwecken. Dabei sind Frauen meist gut ausgebildet – trotzdem unterbrechen sie ihr Erwerbsleben und setzen es dann häufig nur reduziert fort. Die Folge: Sie verdienen weniger, sind von ihren Partnern abhängig und sind insbesondere im Fall von Trennungen – wo sie in der Regel zu Alleinerzieherinnen werden – und im Alter armutsgefährdet oder von Armut betroffen. Während die Vorarlbergerinnen österreichweit am wenigsten verdienen, verdienen die Vorarlberger am meisten. Dies gilt für Teilzeit- und für Vollzeitbeschäftigte. Unselbständig Beschäftigte Vorarlberger verdienten im Jahr 2019 durchschnittlich um 19.648 Euro mehr als Vorarlbergerinnen, im österreichischen Schnitt beträgt diese Differenz 13.743 Euro. Gehen Väter überhaupt in Karenz, dann viel kürzer und im Gegensatz zu den Frauen haben sie keine Einkommensverluste zu verzeichnen. Bei der Wahl der Schule / des Schulzweigs sind die traditionellen Rollenbilder immer noch stark wirksam. Die wirtschaftsberuflichen höheren Schulen und die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik werden fast zu 100 Prozent von Mädchen gewählt. Auch die Wahl des Lehrberufes ist nach wie vor sehr traditionell geprägt. Bei Mädchen sind die drei beliebtesten Lehrberufe schon seit vielen Jahren: Einzelhandelskauffrau, Friseurin und Bürokauffrau. Nach jahrzehntelangem Bemühen, mehr Frauen in technische Berufe zu bringen, liegt der Beruf der Metalltechnikerin inzwischen an vierter Stelle der beliebtesten Lehrberufe.
Weitere geschlechterspezifische Unterschiede sind beispielsweise: Nur zehn Prozent der Alleinerziehenden sind in Vorarlberg Väter. Weniger als ein Drittel der Männer leisten in Österreich täglich Koch- und/oder Hausarbeit. Männer sind in Vorarlberg häufiger in organsierter Form in der Freiwilligenarbeit tätig als Frauen. Frauen sind deutlich stärker von psychischen Erkrankungen betroffen als Männer. Der Frauenanteil unter den Opfern in Bezug auf strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung beträgt 84,6 Prozent, Tendenz steigend.[1] Von außerfamiliärer Kinderbetreuung wird immer häufiger Gebrauch gemacht, wenn auch das Angebot gerade in ländlichen Gemeinden noch immer sehr lückenhaft ist. Jedoch findet sich in der Gesellschaft noch oft die Ansicht, dass Mütter bevorzugt weniger Einkommen beziehen sollten, um sich um die Kinder kümmern zu können. So stimmen laut einer 2018 veröffentlichten Studie der Universität Wien[2] 63 Prozent der Befragten der Aussage zu: Das Familienleben leidet bei vollzeitberufstätiger Frau. Und 53 Prozent bejahten, dass Kinder bei einer berufstätigen Mutter wahrscheinlich leiden würden. Des Weiteren geben 40 Prozent an, dass sie folgender Aussage zustimmen: „Was Frauen wirklich wollen, ist Heim und Kinder.“ Alternativen Rollenmodellen wird bis dato in der Öffentlichkeit noch wenig Platz eingeräumt. Obwohl es auch in Vorarlberg Familien gibt, die derartige Alternativen leben, sind diese wenig sichtbar. Gerade diese Sichtbarkeit wäre jedoch wichtig, um Familien in ihren individuellen Wegen zu stärken. Im ländlichen Raum sind Themen und Problemstellungen in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit häufig spezifisch gelagert. Oft fehlt es an Bewusstsein und an entsprechenden Strukturen, Anlaufstellen und Ansprechpersonen.
Dass sich die beschriebene Situation in Vorarlberg ändern sollte, ist politisch gewollt: Um die Gleichstellung von Frauen und Männern weiter voranzutreiben, entwickelte das Land Vorarlberg im Jahr 2008 gemeinsam mit den Sozialpartner:innen, Nichtregierungsorganisationen und Fachleuten aus Wirtschaftsunternehmen und Bildung den ersten Regionalen Aktionsplan (RAP) für die Jahre 2009-2013. Im Regierungsprogramm 2019 der Vorarlberger Landesregierung ist als ein Ziel verankert, die Rollen von Männern und Frauen ausgeglichen zu verteilen, um die Chance auf gerechte Lebensmodelle zu fördern. Für die Jahre 2019 bis 2023 beschloss die Landesregierung einen neuen Aktionsplan[3], der für die Bereiche Ausbildung, Erwerbsarbeit / Einkommen / soziale Situation, politische Partizipation sowie Hausarbeit und Kinderbetreuung eine Reihe an konkreten Maßnahmen vorschlägt.
[1] Vorarlberger Gleichstellungsbericht 2021 (https://vorarlberg.at/documents/302033/472097/Vorarlberger Gleichstellungsbericht 2021.pdf/a4bbfc76-d044-1e80-7d1e-5907f087d8c6?t=1625208179116) [2] Universität Wien, Interdisziplinäre Werteforschung, 2018: Erste Ergebnisse der Europäischen Wertestudie, Teil 2: Arbeit und Familie, Folie 10. [3] Regionaler Aktionsplan für Gleichstellung von Frauen und Männern in Vorarlberg 2019-2023
Ziele und Zielgruppen
Für femail, den Vorarlberger Familienverband und den Verein Amazone ist Geschlechtergerechtigkeit zentrales Thema in der täglichen Arbeit. Mit dieser Expertise sind die Fachorganisationen an der Umsetzung des Regionalen Aktionsplans für Gleichstellung von Frauen und Männern des Landes Vorarlberg beteiligt. Im Projekt „Rollen im Wandel“ hatten sich die Organisationen gemeinsam zum Ziel gesetzt, mit Unterstützung der Regionalentwicklung Vorarlberg das Thema Geschlechtergerechtigkeit insbesondere in ländlichen Räumen vor den Vorhang zu holen, Rollenbilder zunächst sichtbar zu machen, um sie anschließend auflösen zu können und neue Initiativen in die Gemeinden zu bringen. Anhand verschiedener Formate und Initiativen sollte das Projekt zeigen, dass Rollen nicht wie mehrheitlich üblich traditionell verteilt sein müssen, sondern dass es viele weitere Möglichkeiten gibt, wie das Zusammenleben in Partnerschaften und im Gemeindeleben gelingen kann. Hierfür war es wichtig, in den Gemeinden gemeinsam mit verschiedenen Zielgruppen wie Jugendlichen, Familien, Betrieben und Gemeindevertreterinnen und -vertretern die Bedürfnisse zu erheben und entstandene Ideen pilothaft und praxisnah durch Initiativprojekte umzusetzen.
Ziel war auch, diese Initiativen zu begleiten und aus den gemeinsamen Erfahrungen zu lernen. Gleichzeitig war die Sensibilisierung für Geschlechtergerechtigkeit wesentlich, um langfristig eine gemeinschaftliche Rollenteilung positionieren zu können. Die Projektaktivitäten sollten den Fokus auf die Chancen legen, neuen, innovativen Ideen Raum geben und Menschen, die sich nicht täglich bewusst mit den Projektthemen auseinandersetzen, einen niederschwelligen Zugang hierzu ermöglichen. Das Projekt richtete sich an ein breites Publikum mit den drei Hauptzielgruppen Bevölkerung, Verantwortliche in den Gemeinden, Betriebe.
Projektumsetzung und Maßnahmen
Zu Beginn des Projekts wurden interessierte Gemeinden und ihre Akteurinnen und Akteure, etwa Betriebe, Vereine, Sozial- und Bildungseinrichtungen, im Rahmen eines Startworkshops intensiv an das Thema herangeführt: Welche sozialen Rollen werden in der Region wahrgenommen und was haben diese mit den Geschlechterrollen zu tun? Was müsste sich ändern, damit alle in der Gesellschaft sich gerecht behandelt fühlen? Wer in eurer Gemeinde möchte aktiv werden, damit sich etwas ändert? Auf Basis der Antworten passten die Projektpartnerinnen und Partner ihre Angebote individuell auf die Ausgangssituationen und Bedürfnisse in den jeweiligen Regionen an. Um Zusammenhänge zwischen Geschlechterrollen und gesellschaftlichen Veränderungspotentialen für gerechtere Zugänge erlebbar zu machen, entwickelten die Fachorganisationen neue Aktivitäten und setzten diese um oder begleiteten Akteurinnen und Akteure in den Regionen bei der Umsetzung neuer Aktivitäten – je nachdem, was in der jeweiligen Gemeinde oder Region gerade am besten passte. So entstanden beispielsweise ein Podcast und Buchvorstellungen. Die Initiatorinnen eines neuen Mädchentreffs wurden fachlich begleitet. Parallel dazu stellten die Fachorganisationen den Gemeinden und weiteren Akteurinnen und Akteuren bestehende Formate wie Vorträge oder Workshops zur Verfügung, die Möglichkeiten der Auseinandersetzung und Reflexion mit Geschlechtergerechtigkeit, Rollenbildern und Vielfalt eröffneten. Eine Übersicht aller Formate, die die Fachorganisationen im Rahmen des Projekts anboten, wurde den Gemeinden und Regionen im Gebiet der Regio-V per Email und über das Internet zur Verfügung gestellt. Die Projekt-Webseite www.regio-v.at/rollen-im-wandel (https://www.regio-v.at/projekte/rollen-im-wandel/) informierte über Neuigkeiten, die Angebote der Fachorganisationen, die Initiativen im Rahmen des Projekts, Veranstaltungen sowie über die Themen Geschlechtergerechtigkeit und Rollenbilder. Darüber hinaus wurde das Projekt über die Kanäle der Fachorganisationen sichtbar gemacht: Webseiten, Newsletter, soziale Medien. Für Akteurinnen und Akteure in Gemeinden wurden Karten erstellt, die mit einem Augenzwinkern vielfältige Perspektiven zu fünf Bereichen rund um Geschlechtergerechtigkeit thematisieren und Umsetzungstipps geben. Die Ideenkarten wurden in den Projektregionen verteilt. Alle Angebote im Projekt waren für die Teilnehmenden kostenfrei.
Die entstandenen Kosten wurden über das Projektbudget oder über Kooperationspartnerinnen und -partner, die an einzelnen Formaten beteiligt waren, abgedeckt. Zur internen, organisationsübergreifenden Abstimmung traf sich das Projektteam regelmäßig. Das „Voneinander-Lernen“ und die gemeinsame Arbeit ermöglichten neue Formate. Das Projekt schuf den Rahmen für die Fachorganisationen, um ähnlich einer Innovationsabteilung bei einem Betrieb Ressourcen, Zeit und Legitimation für die Entwicklung neuer Formate für den ländlichen Raum bereitzustellen.
Ergebnisse und Wirkungen
- 18 Jour fixe Termine zur Abstimmung, Planung und Konzipierung
- 16 Podcastfolgen mit Erfahrungsberichten aus nicht alltäglichen Familien
- 9 Aktionen für Väter mit Kindern mit Austausch, Spaß und Action
- 5 Workshops für Gemeinden, Betriebe und die Bevölkerung
- 5 Museums- und Dorfführungen zur Frauengeschichte im Montafon
- 3 Buchvorstellungen mit ausgewählten Romanen zum Rollenwandel
- 2 Vorträge zum Lernen und Reflektieren über Geschlechterrollen
- 2 Ausstellungen zum Klassismus und Rollenvorstellungen
- 1 Theaterabend kombinierte Impro-Theater und Fachvortrag
- 1 Erzählcafé zum Austausch über Rollen- und Familienmodelle
- 1 Austausch für neu zugezogene Frauen in Vorarlberg: ankommen, sich zurecht finden und Kontakte knüpfen
- Begleitung beim Aufbau eines Mädchentreffs: Empowerment von Ehrenamtlichen
- 1 Projekt-Webseite: Alles Wissenswerte rund um das Projekt und darüber hinaus
- 5 Ideenkarten für lebenswerte Gemeinden, mit einem Augenzwinkern
- 1 Abschlusspublikation: Damit andere von den Erfahrungen und Erkenntnissen lernen können
- 7 Kurzvideos mit Begleitheft für Lehrpersonen über repräsentative Gemeindepolitik in Vorarlberg