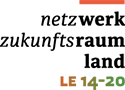ARGE Ammosafe
Emissionsarme Düngung durch Nährstoffrückgewinnung
- Themenbereich
- Land- und Forstwirtschaft inkl. Wertschöpfungskette
- Umwelt, Biodiversität, Naturschutz
- Innovation
- EIP-AGRI
- Untergliederung
- Landwirtschaft
- Boden
- Luftreinhaltung
- Umweltschutz
- EIP Europäische Innovationspartnerschaft
- Wasser
- Gesundheit
- Projektregion
- Niederösterreich
- Steiermark
- LE-Periode
- LE 14–20
- Projektlaufzeit
- 2019-2022
- Projektkosten gesamt
- 422.309
- Massnahme
- Zusammenarbeit
- Teilmassnahme
- 16.1 Förderung für die Einrichtung und Tätigkeit operationeller Gruppen der EIP "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit"
- Vorhabensart
- 16.01.1. Unterstützung beim Aufbau & Betrieb operationeller Gruppen der EIP für lw. Produktivität & Nachhaltigkeit
- Projektträger
- ARGE Ammosafe
Kurzbeschreibung
Das Projekt Ammosafe hat zum Ziel, Ammoniumstickstoff durch ein technisches Verfahren aus Gülle rückzugewinnen und damit den landwirtschaftlichen Betrieben eine sowohl umwelt- und bodenschonendere als auch sozialverträglichere Möglichkeit der Gülleverbringung an die Hand zu geben. Die moderne Tierhaltung und sich laufend verändernde rechtliche Rahmenbedingungen stellen die Landwirtschaft vor verschiedenste Herausforderungen in den Bereichen der Wirtschaftsdüngerlogistik, der Nährstoffeffizienz, der Sozialverträglichkeit sowie des Luft-, Grundwasser- und Bodenschutzes. Durch die Aufbereitung der Gülle soll es den Betrieben ermöglicht werden, Gülle zeitlich flexibler und pflanzenbaulich zielgerichteter einzusetzen. Durch dieses Vorhaben sollen Emissionen in die Luft (Ammoniak, Lachgas) sowie in das Grundwasser (Nitrat) nach der Gülleverbringung deutlich gesenkt werden. Langfristig ist das Ziel des Projekts, einen Beitrag zur sozial- und umweltverträglichen Landwirtschaft zu leisten.Ausgangssituation
Aktuell sind 94 Prozent der gesamten Ammoniakemissionen in Österreich der Landwirtschaft zuzuschreiben. 50 Prozent davon fallen auf die Ausbringung von Wirtschaftsdünger. Das österreichische Grundwasser ist in einigen Gebieten bereits durch landwirtschaftlichen Dünger belastet. Um weiteren Umweltbelastungen vorzubeugen, hat der Gesetzgeber auf EU-Ebene mit der Nitrat- und der NEC-Richtlinie Normen herausgegeben, die die Düngung - insbesondere auch mit Wirtschaftsdüngern - regeln. Dadurch stehen viele viehhaltende Betriebe vor erheblichen logistischen Herausforderungen. Eine Folge der Regelungen ist, dass sich die Wirtschaftsdüngerausbringung zwangsweise auf die Anbauzeit im Frühjahr konzentriert und hier in ein Spannungsfeld zwischen fachliche Notwendigkeit, Bodenzustand, rechtlichen Rahmen und gesellschaftliche Akzeptanz gerät. Aus diesen Gründen braucht es neuartige Verfahren und Methoden, welche das umwelt- und bodenschonende sowie sozialverträgliche Düngen der landwirtschaftlichen Böden ermöglichen. Bereits entwickelte Verfahren sind aktuell überwiegend Lösungen für Großbetriebe und entsprechen nicht den Anforderungen der kleinstrukturierten österreichischen Landwirtschaft.Ziele und Zielgruppen
Das übergeordnete Ziel des Projekts ist es, einen Beitrag zur umwelt- und sozialverträglichen Landwirtschaft zu leisten. Aus diesem Grund wird ein neuartiges, praxisnahes und hoffentlich wirtschaftliches Verfahren entwickelt, in dem der Ammoniumstickstoff aus der Gülle entfernt und in Form von Ammoniumsulfat gebunden wird. Landwirtinnen und Landwirte können einerseits die Stickstoff-reduzierte Gülle zeitlich flexibler und emissionsärmer ausbringen und haben andererseits die Möglichkeit, die Kulturen mit dem gewonnenen Ammoniumsulfat sehr gezielt zum Zeitpunkt des höchsten Stickstoffbedarfs zu düngen. Konkret werden zwei bereits etablierte technische Verfahren miteinander kombiniert. Zum einem die Feststoffseparation in der Vorstufe und zum anderen Ammoniakstripping in der Nachstufe. Ziele im Projekt sind u.a.: - Bereitstellung eines praktisch umsetzbaren, kostengünstigen und mobilen Verfahrens zur Wirtschaftsdüngeraufbereitung
- Reduktion der Ammoniakemissionen bei der Gülleausbringung
- Reduktion der Nitratausträge in das Grundwasser
- Erhöhung der Nährstoffeffizienz inklusive Evaluierung des Ernteertrags über Feldversuche unter realen Bedingungen
Projektumsetzung und Maßnahmen
Die Operationelle Gruppe besteht aus: - 3 landwirtschaftlichen Betrieben
- Röhren- und Pumpwerk Bauer GmbH
- Landwirtschaftskammer Steiermark (Lead-Partner)
Im Projekt wird ein neuartiges Verfahren zur Aufbereitung von Wirtschaftsdünger im Hinblick auf Durchführbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit getestet. Wesentliche Projektschritte sind:
- Planung und Entwicklung einer mobilen Gülleaufbereitungsanlage inklusive unterschiedlicher Versuchsreihen (pflanzenbauliche Praxisversuche, olfaktorische Messungen etc.)
- Durchführung und Testung der Gülleaufbereitung
- Durchführung der Versuche zur Lagerung der aufbereiteten Gülle und ihrer Verwendung als Dünger
- ökonomische Bewertung des Verfahrens Auswertung, Aufbereitung und Verbreitung der Ergebnisse